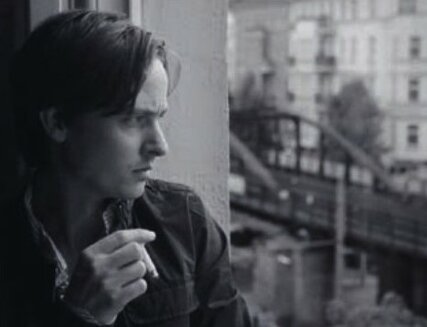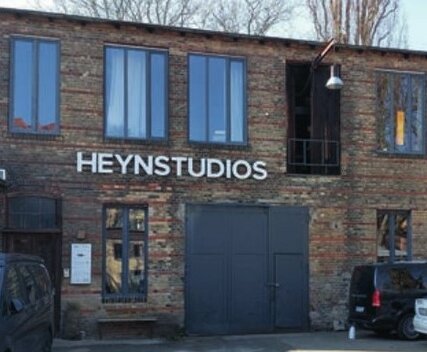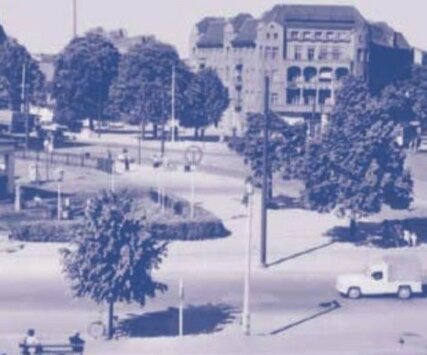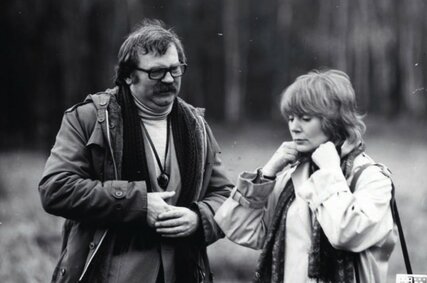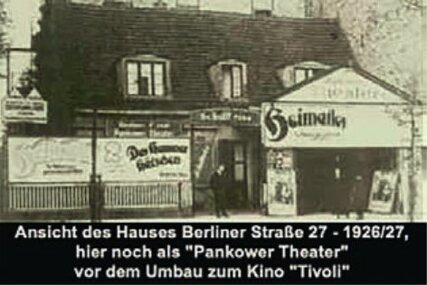Filmgeschichte
Für die meisten gilt Paris als die Geburtsstätte des Films. Doch zeitgleich zu den Franzosen bereitet man auch im ehemaligen Berliner Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg den Weg für die Entstehung des modernen Kinos. 1892 macht der Fotograf Max Skladanowsky mit dem Kurbelkasten erste bewegliche Aufnahmen von seinem Bruder Emil auf dem Dach des Hauses in der Schönhauser Allee 146/Ecke Kastanienallee. Neugierige Fußgänger finden heute an dieser historischen Stelle einen Filmstreifen aus Pflastersteinen mit dem Namen der Berliner Filmpioniere. Schon 1895 veranstalten die Gebrüder Skladanowsky mit dem Bioskop die weltweit erste 15-minütige Filmvorführung vor zahlendem Publikum im Varieté Wintergarten.
Das damals noch arme Viertel war ein Experimentierort für Filmaufnahmen und erfuhr im Laufe eines Jahrhunderts einen sozialen und architektonischen Wandel, der in Filmen neben den eigentlichen Sujets festgehalten wird. Bei den Filmemachern gilt der Stadtteil als die authentischste Kulisse um dem Publikum das Berliner Leben näher zu bringen. Die vom Krieg relativ verschonten Altbauten, abblätternde Fassaden und versteckte Hinterhöfe besaßen Persönlichkeit und waren vor allem für die DEFA-Regisseure ein kontrastreiches Gegenstück zu den charakterlosen Plattenbauten der DDR. Die Lebensformen der hier wohnenden Filmhelden geben über Generationen den Eindruck, sehr typisch für die Verhältnisse der Jugend in der Metropole ihrer Zeit zu sein.
Aufwendigere Produktionen konnten im größeren Lixie-Film-Atelier im Stadtteil Weißensee in der Franz-Josef-Straße 9-12 realisiert werden. Mit dem 1919 gedrehten Stummfilmklassiker „Das Cabinet des Dr. Caligari“ von Robert Wiene wurzelt hier das in den 20er-Jahren aufblühende Genre des expressionistischen Films. Heute erinnert der Caligari-Platz an die Bedeutung des historischen Ortes.
Als exemplarische Eckpfeiler der Pankower Filmgeschichte lassen sich drei herausragende Werke bezeichnen, die im Abstand von etwa 25 Jahren gedreht wurden und die Veränderungen der Ost-Berliner Schauplätze dokumentieren: „Berlin – Ecke Schönhauser“ (1957), „Solo Sunny“ (1980) und „Sommer vorm Balkon“ (2006).
TIPP: Prenzlauerberginale, das Filmfestival für Stadtgeschichte und Kultur
Die jährlich stattfindende Prenzlauerberginale gibt dem Kiez einen Platz auf der großen Leinwand. In verschiedenen Kategorien befasst sich das Filmfestival mit dem beliebten Stadtteil, dessen Bild sich im Laufe der Jahre drastisch gewandelt hat. Die Prenzlauerberginale ist ein Stadtteil-Filmfest mit seltenen Spielfilmen, Dokus, DEFA Archivbildern, Berichten und Musik.
Mehr dazu unter: www.prenzlauerberginale.berlin
KLAPPE: FILMGESCHICHTEN IN UND AUS PANKOW – Thementouren
"location: PANKOW" – Der Bezirk Pankow im zeitgenössischen Film und Fernsehen von 1990 bis heute
Kommen Sie mit auf eine filmische Reise durch Pankow. Besuchen Sie die Schauplätze und Drehorte bekannter deutscher und internationaler Kinofilme und Serienhits von 1990 bis heute.
Der bevölkerungsreichste Bezirk von Berlin ist nicht nur die Heimat von über 400.000 Menschen,sondern auch ein beliebter Drehort für Filmschaffende. Denn wo so viele Menschen leben und arbeiten, lassen sich auch spannende Motive für ganz unterschiedliche Geschichten finden.
Die Tour "location: PANKOW" führt zu den Drehorten von über 20 Filmen und Serien, die nach der Wende im heutigen Bezirk Pankow entstanden sind. Ob Arthouse-Film oder Blockbuster, kleiner deutscher Independentstreifen oder große internationale Produktion: In Pankow haben sie alle gedreht. Wer herausfindenden möchte, wo genau Wim Wenders den Musiker Lou Reed für ein eigens inszeniertes Konzert auftreten ließ, in welchem Hollywoodstreifen eine wilde Verfolgungsjagd zwischen Plattenbauten zu sehen ist, wo in Babylon Berlin wild getanzt wird und Karoline Herfurth "SMS für Dich" verschickt, sollte mit auf Entdeckungsreise gehen. Über die Drehorte lassen sich die Filme und Pankow mit neuen Augen erleben.
Tourenüberblick
Start: Helmholtzplatz
(Raumerstraße / Ecke Dunckerstraße
auf der Grünflächenseite)
Ziel: Jüdischer Friedhof Weißensee
Länge: ca. 18 Kilometer (Radtour)
Dauer: ca. 1,5 Stunden (Fahrtzeit ohne Pausen)
Orte der Thementour
1. Wohnhaus am Helmholtzplatz
Raumerstraße 15 / Ecke Dunckerstraße, 10437 Berlin
Film: Sommer vorm Balkon, D 2005
Regie: Andreas Dresen
Darsteller: Nadja Uhl, Inka Friedrich, Andreas Schmidt
Die Freundinnen Katrin (Friedrich) und Nike (Uhl), beide jenseits der Dreißig, wohnen im selben alten Mietshaus in Prenzlauer Berg in Berlin und verbringen oft zusammen die Abende auf Nikes Balkon. Der titelgebende Balkon befindet sich genau an der Eckseite im vierten Stock des Hauses. Dort trinken die beiden Frauen Wein und schauen in den freien Nachthimmel, von dort beobachten sie die gegenüberliegende Apotheke, wenn sie dem Apotheker einen Telefonstreich spielen. Hier sitzt Nike auch mit ihrem Lover Ronald bei einem ernsten Gespräch, nach diesem Nike ihn dann aus Rache auf dem Balkon aussperrt. In der letzten Einstellung sieht man, wie die Fassade des Hauses mit einem Baugerüst eingerüstet ist. Die Apotheke gegenüber gibt es heute immer noch.
2. Lokal Schönhauser Allee
Schönhauser Allee 146 a, 10435 Berlin
Film: Oh Boy, D 2012
Regie: Jan Ole Gerster
Darsteller: Tom Schilling
Der Endzwanziger Niko (Schilling) hat sein Jurastudium abgebrochen und lebt seitdem in den Tag hinein. Der Film, der an einem einzigen Tag spielt, verzichtet weitgehend auf eine Erzählhandlung und zeigt in episodenhaften Szenen, wie Niko vor der Kulisse Berlins ziellos durch die Stadt treibt und dabei mit teils komischen, teils tragischen Situationen konfrontiert wird. Während des gesamten Films versucht Niko, einen Kaffee zu bekommen (englischer Titel "A Coffee in Berlin"). Erst ganz am Ende des Films, nach 24 aufreibenden Stunden in Nikos Leben, bekommt er seinen Kaffee. Und blickt dabei erschöpft auf die vorbeiratternde U-Bahn. Die Wohnung von Niko ist im selben Haus wie das vietnamesische Restaurant. Von seinem Fenster kann er den Currywurststand von Konnopke sehen. In der Wohnung, die diesen Blick bietet, wohnte damals der Regisseur Jan Ole Gerster.
3. Lokal Kastanienallee/Ecke Oderberger Straße
Kastanienallee 16, 10435 Berlin
Serie: Homeland, (Staffel 5, 12 Folgen), USA/D 2015
Idee: Howard Gordon
Darsteller: Claire Danes, Mandy Patinkin, Rupert Friend, Miranda Otto, Nina Hoss
Homeland ist eine US-amerikanische Fernsehserie. Der Serientitel spielt auf das Department of Homeland Security an. Protagonistin der Serie ist die Geheimagentin Carrie Mathison, die anfangs für den Auslandsgeheimdienst CIA tätig ist und sich in weltweiten Missionen für die Abwehr von Terrorismus einsetzt. Die fünfte Staffel wurde komplett in Berlin und Umgebung gedreht. Homeland war die erste Serie in der Geschichte des US-Fernsehens, für die eine ganze Staffel in Deutschland gedreht wurde. In Folge 9 treffen sich die Berliner CIA-Chefin (und russische Agentin) Allison Carr (Miranda Otto) und die deutsche BND-Agentin Astrid (Hoss) konspirativ draußen in einem Café, damals das Café Godot. Heute befindet sich dort eine Filiale der Restaurants Hako Ramen.
4. Wohnhaus Oderberger Straße
Oderberger Straße 43, 10435 Berlin
Film: Die fetten Jahre sind vorbei, D/A 2004
Regie: Hans Weingartner
Darsteller: Daniel Brühl, Stipe Erceg, Julia Jentsch, Burghart Klaußner
Jan (Brühl), Peter (Erceg) und Jule (Jentsch) sind Mitte 20 und leben in Berlin. Die beiden jungen Männer, seit Kurzem in einer Zweier-WG, haben eine Guerillataktik entwickelt, mit der sie die reichen "Bonzen" verunsichern wollen. Sie brechen in Villen der Berliner Oberschicht ein, verrücken Möbel und hinterlassen Nachrichten wie "Die fetten Jahre sind vorbei" oder "Sie haben zuviel Geld". Die Reichen sollen in ihren privaten Hochsicherheitszonen gestört und zum Nachdenken über ihren Luxus angeregt werden. In dem Haus ist die WG von Jan und Peter. Es ist die Wohnung im zweiten Stock mit dem langen Balkon. Als erste deutschsprachige Produktion seit 1993 nahm der Film beim Filmfestival in Cannes am Wettbewerb um die Goldene Palme teil und wurde vom Publikum gefeiert.
5. Mauerpark
Bernauer Straße, 13355 Berlin
Film: Drei, D 2010
Regie: Tom Tykwer
Darsteller: Sophie Rois, Sebastian Schipper, Devid Striesow
Die Kulturmoderatorin Hanna (Rois) und der Kunsttechniker Simon (Schipper) sind seit 20 Jahren ein Paar. In einer für Simon schwierigen Lebensphase lernt Hanna bei einer Konferenz Adam (Striesow) kennen und beginnt eine Affäre mit ihm. Adam lernt kurz darauf Simon kennen, ohne zu wissen wer er ist, und beginnt auch eine Affäre mit ihm. Der Film wurde hauptsächlich in Berlin gedreht. Vor dem Amphitheater im Mauerpark berichtet Hanna über eine Kunstperformance, bei der unter dem Mauerpark nach Öl gebohrt wird. Dabei trifft sie zufällig Adam wieder, der auf der Wiese vor dem Theater Fußball spielt.
6. Wohnhaus neben Schönfließer Brücke
Kopenhagener Straße 16 / Ecke Sonnenburger Straße, 10437 Berlin
Film: SMS für Dich, D 2016
Regie: Karoline Herfurth
Darsteller: Karoline Herfurth, Friedrich Mücke, Nora Tschirner, Frederik Lau
Die Kinderbuchillustratorin Clara (Herfurth) hat bei einem tödlichen Verkehrsunfall ihren Verlobten Ben verloren. Auch zwei Jahre nach seinem Tod ist ihre Kreativität noch völlig blockiert. Von ihren Freunden angetrieben, entscheidet sie sich, ihrem isolierten Dasein auf dem elterlichen Hof in der brandenburgischen Provinz den Rücken zu kehren und durch einen Umzug zurück nach Berlin den Neuanfang zu wagen. Anders als in der Romanvorlage spielt der Film in Berlin. Gefilmt wurde unter anderem an Orten, mit denen die gebürtige Berlinerin Herfurth nach eigenen Angaben viel verbinde und „das bunte Berlin“ zeigen. In das Haus zieht Clara ein, als sie zu Beginn des Films von Brandenburg zurück nach Berlin zieht.
Film: Das Leben ist eine Baustelle, D 1997
Regie: Wolfgang Becker
Darsteller: Jürgen Vogel, Christiane Paul, Martina Gedeck
Jan (Vogel) lebt in Berlin. Eines Tages verliert er seine Arbeitsstelle in der Fleischfabrik. Zudem eröffnet ihm seine Ex-Freundin, dass sie HIV-positiv ist und ihn vielleicht angesteckt hat. Da lernt er die Musikerin und Lebenskünstlerin Vera (Paul) kennen, als er zufällig in eine Straßenschlacht gerät und sie gegen zwei Zivilpolizisten verteidigt. In dem Haus wohnt Jans Schwester (Gedeck) mit ihrer kleinen Tochter Jenni. Im Film ist vor dem Haus neben der Brücke ein Imbisswagen aufgestellt. Dort kauft Jan seiner Nichte Jenni Pommes, nachdem diese von Nachbarsjungen geärgert wurde. Die Brachfläche gegenüber vom Imbiss, wo die Nichte geärgert wird, ist immer noch nicht richtig bebaut. Da befindet sich heute die provisorische Pizzeria Die Hütte.
7. Mauerradweg
Isländische Straße / Ecke Norwegerstraße; Dolomitenstraße 33, Maximilianstraße
(S-Bahn-Unterführung), Kleingartenanlage Famos, 13187 Berlin
Film: The Invisible Frame, D 2009
Regie: Cynthia Beatt
Darsteller: Tilda Swinton
Der Berliner Mauerweg ist etwa 160 Kilometer lang und folgt weitgehend dem früheren Verlauf der Berliner Mauer um Westberlin. Die Schauspielerin Tilda Swinton fährt in dieser Dokumentation als Touristin den Weg der ehemaligen Mauer durch und um Berlin mit dem Fahrrad ab. Sie startet ihre Tour am Brandenburger Tor und fährt von da entgegengesetzt des Uhrzeigersinns. 1988 schickte die in Berlin lebende britische Filmemacherin Cynthia Beatt die Schauspielerin Tilda Swinton auf eine Radtour durch Westberlin, entlang der Berliner Mauer ("Cycling the Frame"). Gut 20 Jahre später ließ sich Tilda Swinton erneut überreden, den Weg noch einmal zu fahren und nun auch die Ostseite entlang der ehemaligen Mauer zu erkunden.
8. Heynstudios
Heynstraße 15, 13187 Berlin
Fritz Heyn war Fabrikbesitzer und einige Jahre stellvertretender Gemeindevorsteher in Pankow. Seine Produktionsstätte für Stuhlrohre (Peddigrohre) befand sich daneben, in der Florastraße 20-22. Die erste Etage des Wohnhauses der Familie Heyn ist heute das Museum Pankow (Standort Heynstraße). Seit 1974 können die Räumlichkeiten besichtigt werden. Das Fabrikgelände in der Heynstraße 10-15 wurde als Heynhöfe bekannt. Heute finden sich hier die Heynstudios, Designer, Marketingfachleute, Künstler, Handwerker und seit November 2015 auch ein "Bar-Café", das den Namen von Fritz Heyn trägt. Die Heynhöfe sind heute auch als Studio für Filmproduktionen zu mieten.
Serie: Der Greif, D 2023, (1 Staffel)
Regie: Sebastian Marka, Max Zähle
Darsteller: Jeremias Meyer, Lea Drinda, Zoran Pingel, Theo Trebs
Die fiktive Kleinstadt Krefelden im Jahr 1994: Der 16-jährige Mark (Meyer) betreibt neben der Schule zusammen mit seinem großen Bruder Thomas (Trebs) und seinem Freund Memo (Pingel) einen Plattenladen. Als das neue Mädchen Becky (Drinda) in die Stadt zieht, kommen Mark und sie sich bald näher. Eines Tages führt Thomas seinen kleinen Bruder in eine alte Familientradition ein: Mark soll seinen Namen in die Familienchronik eintragen. Es beschreibt eine fantastische Welt, in der ein grausames Wesen, der Greif, seine Schreckensherrschaft ausübt und die laut Thomas wirklich existiert. Die Serie basiert auf dem Fantasy-Roman Der Greif von Wolfgang und Heike Hohlbein aus dem Jahr 1989. Die Serie (6 Folgen) wurde im Auftrag von Amazon Prime realisiert und im Mai 2023 veröffentlicht.
Der Plattenladen Orakel von LP der Brüder ist im Innenhof der Heynhöfe. Das Studio wurde darüber hinaus in ein Büro umgewandelt.
9. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium
Görschstraße 42/44, 13187 Berlin
1910 erbaut, war der Schulkomplex damals der größte in Groß-Berlin und galt als eines der schönsten Bauwerke nicht nur Pankows, sondern der ganzen Umgebung. Die Fassade des bis zu einer Höhe von vier Stockwerken reichenden Baus ist im Stil der Spätrenaissance gehalten. Die Schule wurde mehrmals umbenannt, seit 1950 heißt sie Carl-von-Ossietzky-Oberschule.
Film: Was nützt die Liebe in Gedanken, D 2004
Regie: Achim von Borries
Darsteller Daniel Brühl, August Diehl, Anna Maria Mühe, Jana Pallaske
Paul Krantz (Brühl), der junge, aus einer Arbeiterfamilie stammende Poet, und Günther Scheller (Diehl), der wilde und sehnsuchtsvolle Sohn einer zum gehobenen Bürgertum gehörenden Familie, verbringen ein rauschendes Fest im Sommerhaus der Schellers. Die so genannte "Steglitzer Schülertragödie" ereignete sich im Jahr 1927. Günther Scheller und Paul Krantz hatten einen "Selbstmörderclub" gegründet und sich selbst auferlegt, dann aus dem Leben zu scheiden, wenn sie keine Liebe mehr empfänden. Günther Scheller hatte demnach am 28. Juni 1927 zuerst seinen Geliebten Hans Stephan und danach sich selbst getötet. Der spektakuläre Prozess fand auch im europäischen Ausland, in den USA und in Japan Interesse. Während des Prozesses wurden Günthers Schwester Hilde Scheller und Paul Krantz als Exempel einer moralisch zerrütteten Jugend dargestellt, die ausschweifend und übermäßig früh sexuell aktiv sei. Paul Krantz wurde wegen Mordes und Anstiftung zum Mord angeklagt, jedoch letztendlich in allen relevanten Punkten freigesprochen. In der Eröffnungssequenz ist die Fassade des Gymnasiums zu sehen, um so den schulischen Handlungsort der Geschichte zu setzen.
Film: Sonnenallee, D 1999
Regie: Leander Haußmann
Darsteller Alexander Scheer, Alexander Beyer, Teresa Weißbach, Robert Stadlober
Erzählt wird die Geschichte von Michael Ehrenreich (Scheer) und seinem besten Freund Mario (Beyer) in Ost-Berlin 1973. Beide wohnen am kürzeren Ende der Sonnenallee, besuchen die EOS (Erweiterte Oberschule) Wilhelm Pieck und stehen, wie die anderen Jungs aus der Clique, kurz vor dem Abitur. Neben der Frage, ob man sich um des Studiums willen für drei Jahre bei der NVA verpflichten soll, spielen die größtenteils verbotene West-Pop- und Rockmusik der 1970er Jahre, und natürlich die erste Liebe bzw. Mädchen für sie eine große Rolle.
Die Aula des Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums wird im Film zur Aula der "EOS Wilhelm Pieck". Hier finndet eine FDJ-Veranstaltung statt. Auf der hält auch Michas Schwarm Miriam (Weißbach) eine "linientreue" Rede. Die Aula ist heute renoviert. Im Vergleich mit den Filmbildern ist sie aber immer noch gut zu identifizieren.
10. Wohnhaus mit Café Jasmino
Berliner Straße 114, 13189 Berlin
Film: Lola rennt, D 1998
Regie: Tom Tykwer
Darsteller: Franka Potente, Moritz Bleibtreu
Die rothaarige Lola (Potente) und der blondierte Manni (Bleibtreu) sind ein Paar. Manni, der als Kurier für einen Hehler arbeitet, ruft sie aus einer Telefonzelle an. Er hat eine Plastiktüte mit 100.000 Mark versehentlich in der U-Bahn liegen gelassen. Lola beschwört ihn, noch bis 12.00 Uhr auf sie zu warten, ihr werde ein Ausweg einfallen. Nach diesem Intro erzählt der Film drei verschiedene Varianten, was genau in diesen 20 Minuten passiert. In der Anfangssequenz des Films erklärt Lola, warum sie zu spät zum Treffpunkt mit Manni gekommen ist: Sie wollte nur kurz Zigaretten kaufen und vor dem Laden wird ihr Roller geklaut. Dieser Laden ist heute das Café Jasmino.
11. Innenhof beim Spielplatz Binzstraße
Arnold-Zweig-Straße / Ecke Neumannstraße, 13189 Berlin
Film: Wer ist Hanna? (OT: Hanna), USA/D/UK 2011
Regie: Joe Wright
Darsteller: Saoirse Ronan, Cate Blanchett, Eric Bana
Der Teenager Hanna (Ronan) wird von ihrem Vater (Bana), einem ehemaligen CIA-Agenten, isoliert in den finnischen Wäldern zur Kampfmaschine ausgebildet. Verfolgt wird sie dabei von CIA-Agenten, die von der skrupellosen Geheimdienstleiterin Marisa Wiegler (Blanchett) gelenkt werden. Die hat ein ganz besonderes Interesse an dem Mädchen … Der Showdown des Films findet im ehemaligen Vergnügungspark Plänterwald statt. Die Kulisse des 2001 aufgegebenen Spreeparks diente Regisseur Wright vor allem dazu, Heldenreise und Seelenzustand seiner Protagonistin Hanna zu bebildern. In dem langgezogenen Gebäuderiegel ist die Erdgeschosswohnung von Hannas Großmutter Katrin (Gudrun Ritter), wo sie von Marisa erschossen wird und in die Hanna später über den Balkon einsteigt.
12. Hoffnungskirche Pankow
Elsa-Brändström-Straße 36, 13189 Berlin
Film: B-Movie: Lust & Sound in West-Berlin 1979–1989, D 2015
Regie: Jörg A. Hoppe, Klaus Maeck, Heiko Lange
B-Movie ist ein essayistischer Dokumentarfilm über die Westberliner Musik-und Kunstszene der 80er Jahre. Hauptprotagonist ist Mark Reeder, aus dessen persönlicher Perspektive erzählt wird. Angeregt vom musikalischen Einfluss deutscher Bands wie Kraftwerk, Neu!, Tangerine Dream u. a. zieht Reeder Ende der 70er Jahre nach West-Berlin in ein besetztes Haus und taucht in die dortige Avantgarde-, Musik- und Hausbesetzerszene ein. In der Szene geht es um ein Konzert der Toten Hosen im Hof der Kirche am 9. April 1988. Reeder suchte nach einem ersten Untergrund-Konzert der Toten Hosen in der Erlöserkirche in Berlin-Rummelsburg vom 27. März 1983 eine geeignete Fortsetzung. Das Konzert wurde als Benefizkonzert für rumänische Waisenkinder getarnt.
13. Theater im Delphi
Gustav-Adolf-Straße 2, 13086 Berlin
Das ehemalige Stummfilmkino wurde von dem Architekten Julius Krost geplant und als letztes Stummfilmkino 1929 mit 870 Plätzen eröffnet. Es ist mit dem Aufschwung der Kinobranche der 1920er und 1930er Jahre fest verbunden. Der Standort in Berlin-Weißensee wurde durch die zahlreichen Filmproduktionsstätten auch "Klein Hollywood" genannt. Das Innere ist heute überwiegend erhalten und lässt den Charme des vorigen Jahrhunderts erkennen.
Serie: Babylon Berlin, D seit 2017 (4 Staffeln)
Regie: Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten
Darsteller: Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Lars Eidinger
Babylon Berlin ist eine deutsche Fernsehserie, die auf den Ideen und Büchern der Erfolgsromane von Volker Kutscher beruht. Schauplatz ist das Berlin am Ende der Weimarer Republik. Hauptfiguren sind der Kommissar Gereon Rath (Bruch) und die Berlinerin Charlotte Ritter, die erst mit Gelegenheitsarbeiten, später auch als Kriminalassistentin bei der Polizei beschäftigt ist und mit Rath gemeinsam an der Lösung der Fälle arbeitet. Die Serie war am Ende der Produktion von Staffel 1 und 2 mit einem Budget von knapp 40 Millionen Euro die bislang teuerste deutsche Fernsehproduktion und teuerste nicht-englischsprachige Serie.
Im Theater im Delphi werden die Szenen gedreht, die in der Serie im (fiktiven) Nachtclub Moka Efti spielen. Bis jetzt wurde für jede Staffel im Delphi gedreht. So findet z.B. in Staffel 4 ein Tanzmarathon im Delphi statt.
14. Motorwerk Berlin
An der Industriebahn 12, 13088 Berlin
Das denkmalgeschützte Ensemble wurde ab 1921 für die Ziehl-Abegg Elektrizitätsgesellschaft erbaut. Bis zum Zweiten Weltkrieg wurden hier Spezial-Elektromotoren gefertigt. Nach der Wende war das Gebäude unter dem Namen Halle Weißensee oder auch nur Die Halle für Konzerte und Veranstaltungen bekannt. Im Dezember 1991 fand dort die erste Mayday-Veranstaltung Deutschlands statt. Neben zahlreichen anderen Techno-Veranstaltungen in den Folgejahren gastierten dort auch Kraftwerk, The Velvet Underground, Motörhead, Marianne Rosenberg, die Red Hot Chili Peppers und viele mehr.
Film: In weiter Ferne, so nah!, D 1993
Regie: Wim Wenders
Darsteller: Otto Sander, Bruno Ganz, Horst Buchholz
Der Engel Cassiel (Sander) ist traurig darüber, dass er als ein Unsterblicher die Menschen wegen ihrer Sorgen nur trösten kann, anstatt aktiv in ihr Schicksal eingreifen zu können, ohne selbst ein Mensch zu werden, so wie es seinem Freund und ehemaligen Engel Damiel (Ganz) passiert ist. Aber eines Tages rettet Cassiel ein Mädchen, die kleine Raissa, und wird danach ebenfalls zum Menschen. Der Film ist die Fortsetzung von Wenders Kultfilm Der Himmel über Berlin (1987). Endlich konnte Wenders auch auf der Ostseite der Stadt drehen. Der Film gewann beim Filmfestival Cannes 1993 den Großen Preis der Jury.
Cassiel besucht ein Konzert von Lou Reed, der auch sonst noch Auftritte in dem Film hat und sich selbst spielt. Dieses Konzert findet im Motorwerk statt. Gedreht wurden die Konzertszenen eine Woche vor dem eigentlichen Drehbeginn während Lou Reeds Europatour. Für die Aufnahmen des Filmkonzerts, das kein offizielles Konzert von Lou Reed war, wurden ausdrücklich Statisten gesucht, die auch Fans von Lou Reed waren. Im Anschluss spielte Lou Reed spontan für die Statisten, die sich zehnmal den Song "Why can‘t I be good" angehört hatten, noch eine Handvoll anderer Lieder als Entschädigung.
15. Park am Weißen See
Parkstraße, 13086 Berlin
Serie: Weißensee (Staffel 1), D 2010-2018 (4 Staffeln, jeweils 6 Folgen)
Regie: Friedemann Fromm
Darsteller: Florian Lukas, Hannah Herzsprung, Uwe Kockisch, Katrin Sass, Jörg Hartmann
Die Serie schildert das Schicksal der Familien Kupfer und Hausmann in Ost-Berlin in den Jahren 1980 (1. Staffel) bis 1990 (4. Staffel). Schauplatz ist überwiegend der Ortsteil Weißensee. Gleich in der ersten Folge der ersten Staffel gehen Julia und Martin bei ihrem ersten Date im Park am Weißen See spazieren und machen dabei auch einen kurzen Stopp auf der Seebrücke mit Blick auf den Weißen See.
16. Wohnhaus Woelckpromenade
Woelckpromenade 7, 13086 Berlin
Das Gebäudeensemble in der Woelckpromenade ist Teil des sogenannten Munizipalviertels von Weißensee. Um 1900 wirkte sich die Stadterweiterung Berlins zunehmend auf die umliegenden Gemeinden aus: Mit dem Ausbau der elektrischen Straßenbahnlinien rückten auch Vororte wie Weißensee in den Fokus der Stadtplaner. Dort forcierte seit 1906 der Bürgermeister Carl Woelck die Modernisierung und Neugestaltung der Ortschaft, um das Stadtrecht zu erhalten, was aber nie gelang. Das Wohnhaus Woelckpromenade 7 stand mindestens seit den 2010er-Jahren leer und diente lediglich als mondäne Kulisse verschiedener Film- und Serienproduktionen.
Serie: Babylon Berlin, (Staffel 3 und 4), D seit 2017 (4 Staffeln)
Regie: Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten
Darsteller: Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Lars Eidinger
Ab Staffel 3 ist in dem Haus die Wohnung von Gereon Rath. In einer Szene in Staffel 4 soll der gerichtsmedizinische Assistenz Rudi einen Bericht zu Rath nach Hause bringen und wird auf dem Weg dahin auf der Grünfläche vor dem Schulgebäude ermordet.
Serie: Deutschland ’89, D 2020
Showrunner: Anna Winger, Jörg Winger
Darsteller: Jonas Nay
Deutschland ’89 ist die die dritte Staffel einer deutschen Serie. Die erste Staffel lief unter dem Titel Deutschland ’83 (2015, 8 Folgen), die zweite unter dem Titel Deutschland ’86 (2018, 10 Folgen). Die Serie erzählt von dem ehemaligen DDR-Grenzsoldaten Martin Rauch (Nay), der von der Staatssicherheit als Spion in die BRD eingeschleust wird. In der dritten Staffel Deutschland ’89 (8 Folgen) wird Martin Rauch unter anderem in eine westdeutsche Terrorzelle eingeschleust und in das Attentat auf den Banker Alfred Herrhausen in Frankfurt/Main verstrickt. Die Serie bekam viel Lob von Kritikern und lief sogar in den USA und Großbritannien mit Erfolg. Sie gewann etliche Auszeichnungen, wie die Goldene Kamera, Grimme Preis, Deutscher Fernsehpreis, International Emmy Award und den Deutschen Fernsehpreis für den besten Hauptdarsteller.
Die Szenen um das Attentat auf Herrhausen in Frankfurt sind am Kreuzpuhl an der Woelckpromenade entstanden. Um den Bezug zu Frankfurt glaubhaft zu gestalten, wurden am Computer im Hintergrund Frankfurter Bürotürme integriert.
17. Jüdischer Friedhof Weißensee
Herbert-Baum-Straße 45, 13088 Berlin
Der Jüdische Friedhof Berlin-Weißensee ist ein 1880 angelegter Begräbnisplatz der Jüdischen Gemeinde zu Berlin. Er ist mit rund 42 Hektar der flächenmäßig größte jüdische Friedhof Europas mit fast 116.000 Grabstellen. Seit den 1970er Jahren steht er unter Denkmalschutz.
Film: Alles auf Zucker, D 2005
Regie: Dany Levy
Darsteller: Henry Hübchen, Hannelore Elsner, Udo Samel
Der arbeitslose ehemalige DDR-Sportreporter und passionierte Billard-Spieler Jakob Zuckermann alias Jaeckie Zucker (Hübchen) sieht sich schon lange nicht mehr als Jude. Der Berliner steckt tief in finanziellen Problemen, als ihn die Nachricht vom Tod seiner Mutter erreicht und mit ihr die Hoffnung auf eine Erbschaft, die ihm aus der Klemme helfen könnte. Das Testament trifft Zucker jedoch doppelt: Die Mutter hat bestimmt, dass im Anschluss an ihre Beerdigung auf dem Jüdischen Friedhof Berlin-Weißensee eine siebentägige Trauerzeit nach jüdischer Tradition ausgerichtet werden soll (Schiv’a), und diese soll Zucker ausgerechnet gemeinsam mit seinem strenggläubigen Bruder Samuel aus dem Westen durchführen. Erst wenn sich die seit Jahrzehnten zerstrittenen Brüder im Rahmen der Trauerzeit wieder versöhnen, bekommen sie ihr Erbe. Der Film war ein großer Überraschungserfolg nicht nur bei der Kritik, sondern auch bei den Zuschauern. Über 1.000.000 Zuschauer sahen sich den Film in den deutschen Kinos an. Zur Beerdigung der Mutter von Jaeckie (Hübchen) und Samuel (Samel) kommt die Familie auf dem Jüdischen Friedhof Weißensee zusammen. Am Grab simuliert Jaeckie einen Herzanfall und fällt ins offene Grab.
Serie: Unorthodox, D 2020 (1 Staffel, 4 Folgen)
Regie: Maria Schrader
Darsteller: Shira Haas
Die Miniserie, die im Auftrag von Netflix produziert wurde, erzählt die Geschichte der 19-jährigen Etsy (Haas), die die ultra-orthodoxe jüdische Religionsgemeinschaft der Satmarer in New York verlässt und ein neues Leben in Berlin anfängt. Die in Amerika spielenden Szenen basieren lose auf dem 2012 erschienenen Buch Unorthodox von Deborah Feldman, in dem sie Erlebnisse ihrer Kindheit und Jugend beschreibt. Der Handlungsstrang in Berlin ist hingegen fiktiv. Gedreht wurde die Serie im Sommer 2019 fast nur in Berlin. In Folge 3 besuchen Etsys Mann Yakov und sein Cousin Moische den jüdischen Friedhof Weißensee, um ein bestimmtes Grab zu finden und dort für Führung bei der Suche nach Esty zu beten.
Serie: Babylon Berlin (Staffel 4), D seit 2017 (4 Staffeln)
Regie: Tom Tykwer, Achim von Borries, Hendrik Handloegten
Darsteller: Volker Bruch, Liv Lisa Fries, Lars Eidinger
In Staffel 4, die in den Jahren 1930 und 1931 spielt, wird die Welt orthodoxer Juden im Berlin der Weimarer Republik thematisiert. In einer Szene besucht der amerikanische Gangster Abraham Goldstein (Mark Ivanir) – der in die USA emigriert ist und nun nach Berlin zurückkehrt ist, um einen wertvollen Edelstein aus dem Familienbesitz wiederzubeschaffen – das Grab seines Onkels Moses Abraham Goldstein. Ein entsprechender Grabstein wurde extra für den Film angefertigt und auf dem Friedhof aufgestellt.
FLYER „location: PANKOW“ - Der Bezirk Pankow im zeitgenössischen Film und Fernsehen von 1990 bis heute - DOWNLOAD
"Von Klein Hollywood nach Babylon Berlin" – Reise durch die Filmstadt Weißensee
Den Spitznamen "Klein Hollywood" hat sich Weißensee wahrlich verdient. Hier befanden sich in der frühen Weimarer Republik einige der wichtigsten Filmstudios Deutschlands.
Ab 1913 wurden vor den Toren von Berlin Filme gedreht. Hier entstand der Stummfilmklassiker "Das Cabinet des Dr. Caligari", hier wurden Kulissen für große Monumentalfilme wie "Die Pest in Florenz" aufgebaut und hier haben berühmte Namen wie Fritz Lang, Marlene Dietrich, Joe May oder Conradt Veidt gearbeitet. Ein erhaltenes Stummfilmatelier zeugt von dieser großen Zeit des Films. Aber auch außerhalb der Studios, auf den Straßen und Plätzen von Weißensee, haben die Filmemacher ihre Motive gefunden. Drehort Weißensee: das verbindet Serien wie "Babylon Berlin", "Weißensee" oder "Deutschland 89".
Gezeigt wurden die Filme damals in den zahlreichen Kinos. Zwei Kinogebäude, das Delphi und das Toni, sind erhalten geblieben. Kommen Sie mit nach Weißensee – in die fast vergessene Filmstadt!
Tourenüberblick
Start: Bürgeramt Weißensee
Berliner Allee 252–260, 13088 Berlin
Ziel: Brotfabrik
Caligariplatz 1, 13086 Berlin
Länge: ca. 8 km
Dauer: ca. 45 Minuten mit dem Fahrrad
oder 3 Stunden zu Fuß
Orte der Thementour
1. Bürgeramt Weißensee (Askania-Haus)
Berliner Allee 252-260, 13088 Berlin
Das Askania-Haus verdankt seinen Namen der "Askania Werke AG", die hier 1943 eingezogen ist. Das im sachlichen Stil gebaute Backsteingebäude war zwei Jahre zuvor für eine chemische Fabrik gebaut worden. Askania hatte sich seit der Gründung 1871 zu einem der wichtigsten Unternehmen in Deutschland für Navigations- und Luftfahrtinstrumente entwickelt. Aber Askania war auch ein bedeutender Hersteller von innovativen Filmprojektoren und Kameras. Fritz Lang vertraute den Askania-Kameras zum Beispiel im Film "Die Frau im Mond" aus dem Jahr 1929. Auch der im selben Jahr produzierte Film "Der blaue Engel" mit Marlene Dietrich wurde mit Askania-Kameras gedreht. Als Kassenschlager erwies sich etwas später die Schulterkamera, die erste ihrer Art überhaupt. 1935 erstmals präsentiert, wurde die Kamera aufgrund ihres geringen Gewichtes und ihrer Robustheit zur wichtigsten deutschen Kriegsberichterstatter-Kamera im Zweiten Weltkrieg.
Nach dem Zweiten Weltkrieg diente das Gebäude kurz als Rathaus Weißensee. Es folgte die Sowjetische Aktiengesellschaft. Von 1953 bis 1990 schließlich nutzte das Ministerium für Staatssicherheit mit der Hauptabteilung Personenschutz das Gelände mit mehreren Tausend Mitarbeitern.
Einige Jahre war das Gebäude dann wieder Rathaus, bis es aufgrund der Bezirksreform zum Bürgeramt abgestuft wurde. Seit 2005 befindet sich im hinteren Teil des Komplexes die Kreativstadt Weißensee. Hier wird ein Kultur- und Gewerbezentrum für Designer, Künstler und kreative Unternehmen entwickelt. Askania selbst wurde 2008 als Manufaktur für Uhren neu gegründet. Um an die Filmtradition der ehemaligen Askania Werke AG zu erinnern, verleiht die Firma seit der Neugründung die Askania Awards mit inzwischen fünf Kategorien.
TIPP: Im Foyer des Rathauses befindet sich eine sehenswerte Dauerausstellung des Museum Pankow zu "100 Jahre Filmstadt Weißensee".
2. Gedenktafel zur Filmstadt Weißensee
Berliner Allee 249, 13088 Berlin
Seit 1995 erinnert eine Gedenktafel an die Vergangenheit von Weißensee als Filmstadt. Dieses fast vergessene Kapitel der Filmgeschichte begann am 1. Oktober 1913 mit der Eröffnung des ersten Filmstudios vor den Toren Berlins. Die frühen Filmstudios waren zumeist Glasateliers auf Dachböden mit natürlichem Licht. Für die jetzt abendfüllenden Filme, für deren Herstellung schwere technische Geräte eingesetzt und aufwändige Kulissen gebaut wurden, brauchte man mehr Platz. Damals gehörte die Gemeinde Weißensee noch nicht zu Berlin und konnte mit viel Freifläche locken. Wie in der damaligen Franz-Joseph-Straße (heute Liebermannstraße). In die Nummer 5-7 zog 1913 mit den "Union Vitascope Studios" die erste Filmfirma in Weißensee ein. Ihr folgten in kurzer Zeit weitere Produktionsfirmen und bedeutende Filmschaffende. Im Sommer 1914 wurde die Firma Continental-Kunstfilm Nachbar der Vitascope Studios. Die beengte räumliche Lage des zweiten Filmstudios in Weißensee führte nach 1920 zu einer Erweiterung des Studiogeländes bis kurz vor die Berliner Allee.
Inzwischen hatte hier Produzent Erich Pommer mit seiner Firma Decla die Studios übernommen und der Name "Lixie-Atelier" setzte sich durch. Erich Pommer war eine der wichtigsten Personen des deutschen Films und verhalf später mit dem Film "Der blaue Engel" Marlene Dietrich zu Weltruhm. Unter Erich Pommer arbeitete auch Regisseur Fritz Lang, damals noch als Drehbuchautor. Fritz Lang schrieb das Drehbuch für einen der aufwändigsten Filme des Studios: "Die Pest von Florenz" (1919). Für die Außenaufnahmen des Historienfilms verwandelte sich das Grundstück in das Florenz der Renaissance. Kritiker und Zuschauer waren begeistert von dieser originalgetreuen Auferstehung der italienischen Stadt in Weißensee. Mit weniger Aufwand gedreht, aber dafür mit einer weitaus größeren Wirkung, entstand in diesen Studios der berühmteste Film "made in Weißensee": "Das Cabinet des Dr. Caligari" (1920) von Robert Wiene. Inflation und Weltwirtschaftskrise bedeuteten für den Filmstandort Weißensee jedoch einen entscheidenden Einschnitt. Die Scheinwerfer gingen nach und nach aus. 1928 wurde das Gelände an eine Wohnungsbaugesellschaft
verkauft.
3. Ehemalige Filmateliers in der Liebermannstraße
Liebermannstraße 24, 13088 Berlin
Die ersten Filmstudios in Weißensee, die den Grundstein für den Erfolg der Filmstadt legten, sind noch erhalten. Die damalige Adresse war Franz-Josef-Straße 5-7, heute heißt sie Liebermannstraße. Am 1. Oktober 1913 zog die Vitascope ein, nachdem ihr Glasatelier in Kreuzberg zu klein geworden war. In der Presse wurde verkündet: "Durch die außergewöhnliche Vergrößerung des Absatzes unserer Filme in allen Teilen der Welt sahen wir uns veranlasst, unsere Fabrikation nach Berlin-Weißensee, Franz-Josef-Straße 5-7 zu verlegen, welche Fabrikationsräume am letzten Montag ihrer Benutzung übergeben wurden. Die Anlage ist die größte Deutschlands."
Zum Komplex gehören ein langgestrecktes, flaches Werkstatt- und Büro-Gebäude und zwei Ateliers. Die Werkstätten verfügten über ein sägezahnähnliches Sheddach, das der besseren Beleuchtung der Werkstätten diente. In der Tischlerei wurden die Kulissen für die Filme gebaut. Im vorderen Teil des Gebäudes befand sich auch eines der damals größten Kopierwerke des deutschen Films. Eine wahre "Filmfabrik", wie es damals hieß. Die Fassade der beiden Ateliers bestand überwiegend aus Glas, damit viel mit natürlichem Licht gearbeitet werden konnte. Wichtig war vor allem der ebenerdige Zugang, der einen großen Vorteil im Vergleich zu den vorher üblichen Dachateliers darstellte. So konnten die schweren Filmgeräte oder Kulissen besser bewegt werden. 1918 mietete Joe May das Filmstudio und leitete eine neue Ära in der Filmgeschichte Weißensees ein. Trotz wirtschaftlicher Schwierigkeiten boomte die Filmbranche in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg. May war zunächst mit Detektivfilmen und später mit Monumentalfilmen wie dem neunteiligen Film "Die Herrin der Welt" (1919) oder "Das Indische Grabmal" (1921) erfolgreich. Doch Mitte der 1920er geriet die Filmmaschine, auch aufgrund der Inflation und Wirtschaftskrise, ins Stocken. Immer weniger Filme wurden hier produziert. Der letzte Film entstand 1928. Regisseur und Hauptdarsteller Harry Piel spielt in dem Sensations-Film "Panik" einen indischen Maharadscha, der verschiedene Abenteuer mit echten Tigern überstehen muss. Neue Nutzer der Filmstudios wurde die Wäscherei und Färberei H. Ide. Zu DDR-Zeiten war die Wäscherei Teil des Kombinates VEB REWATEX. Heute nutzen verschiedene Mieter, auch aus der Kreativszene, die ehemaligen Filmstudios. Dazu gehört auch das Berliner Ensemble, das hier seine Metallwerkstatt unterhält.
4. Joe-May-Platz
Joe-May-Platz, 13086 Berlin
Seit 1999 trägt der Platz den Namen eines großen deutschen Filmpioniers: Joe May. Der aus Österreich kommende Regisseur, der eigentlich Julius Otto Mandel hieß, war mit 94 Filmen in 16 Jahren nicht nur einer der produktivsten und innovativsten Regisseure der deutschen Filmgeschichte. May prägte wie kein anderer das Filmschaffen in Weißensee. Nach seinen ersten Erfolgen mit Detektivfilmen widmete sich May einem anderen Genre, als dessen Erfinder er für das deutsche Kino gilt: dem Monumentalfilm. Mit aufwändigen Kulissen und exotischen Stoffen sprengten seine Filme alle bisher dagewesen Maßstäbe und trafen den Geschmack der Zuschauer gerade in den politisch und wirtschaftlich schwierigen Nachkriegsjahren. Kritiker nannten Joe May damals den "König der Supermonumentalfilme".
Zu diesen teilweise in den Ateliers der "May Film GmbH" in Weißensee produzierten Filmen gehören Titel wie "Veritas vincit" (1919), der achtteilige Film "Die Herrin der Welt" (1919) oder "Das indische Grabmal" (1921/22). Mit diesen Werken wollte May eine Art deutsches Hollywood schaffen. Sein Rezept für erfolgreiche Filme beschrieb er folgendermaßen: "Man nehme eine spannende Handlung, füge eine gewisse Beimischung von humoristischen Szenen sowie auch von starken Sensationen hinzu." Unter May erlebten Schauspieler große Karrieren wie zum Beispiel seine Frau Mia May, die zu einer der ersten Diven des deutschen Films aufgebaut wurde. Eine weitere damals noch völlig unbekannte Schauspielerin hatte einen ihrer ersten Auftritte in dem May-Film "Tragödie der Liebe" (1923): Marlene Dietrich. Bei den Dreharbeiten lerne sie den damaligen Aufnahmeleiter Rudolf Siebel kennen, den sie kurz darauf heiratete. May brachte auch den Regisseur Fritz Lang zum Film, der bereits 1917 für ihn als Drehbuchautor arbeitete und bis zum Beginn seiner großen Karriere noch mehrmals für May tätig war. 1933 musste der gebürtige Jude Joe May emigrieren und ging nach Hollywood, wo er nie an seine großen Erfolge in Deutschland anknüpfen konnte. Er steht auch heute noch im Schatten der anderen Regisseure der Weimarer Republik wie Murnau, Lang, Pabst und Lubitsch. Aber er ist der einzige unter diesen großen Namen, nach dem ein Platz in Berlin benannt ist. Und Kurt Tucholsky nannte May sowieso nur "Joe den Großen".
5. Rennbahnstraße – ehemalige Trabrennbahn
Rennbahnstraße 45, 13086 Berlin
Der Name Rennbahnstraße weist bereits darauf hin: Hier fanden einst Rennen statt. Und zwar sowohl mit Pferden wie auch mit Fahrrädern. Der Startschuss fiel am 16. Juni 1878. Die Eröffnung der Trabrennbahn vor den Toren der Reichshauptstadt Berlin war ein wichtiger Tag in der Geschichte Weißensees. Bald schon strömten Tausende Besucher über staubige Straßen oder mit einer Sonderlinie der Pferdestraßenbahn zu den Rennen. 1912 jedoch endete die Zeit der Pferderenntage in Weißensee. Die neuen Filmgesellschaften entdeckten das Areal, optimal geeignet für Außendreharbeiten unweit der Studios in der Franz-Josef-Straße. Vor allem für die monumentalen Filme des Regisseurs Joe May. Noch während der Erste Weltkrieg in vollem Gange war, produzierte er mit VERITAS VINCIT den ersten echten Monumentalfilm der deutschen Filmgeschichte. Thema des dreiteiligen Films ist der Sieg der Wahrheit über die Lüge, den May in drei verschiedenen historischen Zeiten erzählt: dem antiken Rom, dem späten Mittelalter und der Zeit kurz vor Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Die Bauten verantwortet mit Paul Leni einer der wichtigsten Szenenbildner des frühen deutschen Films. Besonders spektakulär gestaltet er das antike Rom mit seinen Triumphzügen, Festgelagen, Arenakämpfen und blutigen Christenverfolgungen. Ein Nachbau des Circus Maximus wurde der Mittelpunkt des filmischen Roms. Ein Graben trennte die eigentliche Arena von den Tribünen der Zuschauer im Film. Denn es kamen echte Löwen zum Einsatz, denen die gefangenen Christen zum Fraß vorgeworfen werden sollten. Von all dem berichtete die zu Dreharbeiten geladene Presse begeistert. Drei Tage vor der Uraufführung warfen Flugzeuge Hunderttausende von Flugblättern über Berlin ab, fast alle Litfaßsäulen zierten Filmplakate. Als der Film am 4. April 1919 gezeigt wurde, sprach die Presse von einem "Denktag für die deutsche Filmindustrie". Ein Film, der vom Aufwand alles bisher Dagewesene überträfe, ein "Meisterwerk", mit dem man auch dem Ausland zeige: "Der deutsche Film ist auf der Höhe!". Noch einige weitere Filme wurden auf dem Gelände gedreht, aber Joe May zog es bald für Außendreharbeiten nach Rüdersdorf und Woltersdorf.
Auf dem Gelände der ehemaligen Trabrennbahn entstanden nach dem Zweiten Weltkrieg mit Trümmerschutt neue Tribünen und eine Radrennbahn, die 1955 Eröffnung feierte. Für Schlagzeiten sorgten aber vor allem die Konzertveranstaltungen Ende der 1980er Jahre: Am 19. Juli 1988 war Bruce Springsteen zu Gast. Angeblich hörten bis zu 300.000 Menschen "The Boss" zu. In den 1990er Jahren wurden schließlich die Reste der Rennbahn abgerissen. Heute befinden sich auf dem Gelände mehrere Sportfelder. Übrig geblieben von der Rennbahn sind ein rostiger Eisenzaun und Teile der Mauern am Eingang.
6. Park am Weißen See
Plansche am Weißen See, 13086 Berlin
Der Weiße See gab dem heutigen Ortsteil Weißensee seinen Namen. Man kann den fast kreisrunden Badesee auf einem 1,3 Kilometer langen Weg komplett umrunden. Auf seinem Areal finden die Besucher Denkmäler sowie mit dem Café Milchhäuschen, einem Bootsverleih und dem Strandbad auch mehrere Gastronomie- und Freizeitangebote.
Über die Berliner Stadtgrenzen hinaus bekannt wurden See und Ortsteil durch die erfolgreiche Serie "Weissensee". Die Schreibweise mit einem doppelten "s" war dem Vermarktungswunsch der ARD geschuldet, die die Serie mit Großbuchstaben vorstellte. "Weissensee" spielt in der Spätphase der DDR und erzählt die Geschichte der Stasi-Familie Kupfer und der Dissidenten-Familie Hausmann. Ausgerechnet der wichtigste Drehort der Serie, die Villa der Familie Kupfer, befindet sich allerdings nicht, wie zu vermuten, in Weißensee, sondern in Potsdam-Sacrow. Aber der Weiße See taucht gleich in der ersten Folge der ersten Sta# el zweimal prominent auf: In der Eingangsszene spielt Martin, der jüngere Sohn der Kupfer-Familie, mit seiner Tochter auf einem Spielplatz nahe dem Café "Milchhäuschen". Zwar gibt es am Weißen See mehrere Spielplätze. Aber für die Dreharbeiten, die im September 2009 starteten, installierte man Schaukel und andere Spielgeräte, die zum Handlungsjahr 1980 passten. In einer weiteren Szene trifft sich Martin, der für die Volkspolizei arbeitet, mit Julia Hausmann, Tochter der Liedermacherin Dunja Hausmann. Die beiden stehen auf der 1912 nach Plänen des Weißenseer Gemeindebaurats Carl James Bühring errichteten Seebrücke. Störend für die Dreharbeiten erwiesen sich die Graffiti, die zeitlich nicht in das Ost-Berlin der 1980er Jahre passten. Auch andere "Farbtupfer" mussten entfernt, manche Wand mit einer grauen Paste eingeschmiert werden. Was nicht vor Ort angepasst werden konnte, erledigte der Computer im Studio. In der vierten Staffel tauchen der Weiße See und das Milchhäuschen wieder prominent auf. In der Zwischenzeit hatten sich allerdings die Bedingungen für Dreharbeiten am See stark verändert. Während das Filmteam 2009 noch relativ unter sich war, hatte man acht Jahre später nicht nur Probleme mit den Absperrungen, sondern auch mit der Lärmkulisse. Von verschiedenen Seiten des Sees drang laute Musik zum Set und stellte den Toningenieur vor fast unlösbare Aufgaben. 2018 wurde die bisher letzte Staffel von "Weissensee" in der ARD ausgestrahlt.
7. "Brecht-Haus"
Berliner Allee 185, 13086 Berlin
Die kleine Villa ist ein Zeugnis des alten Dorfes und eines der ältesten Gebäude in Weißensee. Errichtet wurde es ungefähr im Jahr 1875. Die Vorstadtvilla im klassizistischen Stil ist symmetrisch aufgebaut und ihr Highzweigeschossiger Mitteltrakt wird von einem Giebel gekrönt. Um die Jahrhundertwende war das Haus ein Restaurant namens "Zum Deutschen Zelt". Vom Garten aus hatte man direkten Blick zum Weißen See. 1925 wurde es ein privates Wohnhaus und nach einer Zwischennutzung durch die Sowjetische Militärkommandantur zog 1949 das Ehepaar Bertolt Brecht und Helene Weigel nach ihrer Rückkehr nach Deutschland ein. Ab 1953 wohnten sie dann in dem heute "Brecht-Haus" genannten Hinterhaus in der Chausseestraße 125 in Mitte. Aber auch das Gebäude in der Berliner Allee wird als "Brecht-Haus" bezeichnet. Brecht lebte hier fast doppelt so lange wie in dem bekannteren Haus in der Chausseestraße. Nach mehreren Jahrzehnten als Klubhaus der Volkssolidarität ist das Gebäude heute im Privatbesitz und wartet dringend auf eine Sanierung.
Bertolt Brecht ist vor allem durch seine Theaterstücke bekannt. Aber auch Film war für ihn früh ein wichtiges Betätigungsfeld. Sein Interesse begann, als er nach Berlin kam und realisierte, wie wichtig Film für Kultur und Gesellschaft geworden war. 1923 entstand ein erster Kurzfilm. Der Erfolg seines Stückes "Dreigroschenoper" weckte sofort das Interesse der Filmindustrie. Für die erste Verfilmung sollte Brecht eigentlich selbst das Drehbuch schreiben. Aber da er radikale antikapitalistische Positionen in dem Film unterbringen wollte, wurde ihm der Vertrag gekündigt. Seine künstlerischen und politischen Ideen konnte er dann in dem Film "Kuhle Wampe oder: Wem gehört die Welt"? umsetzen. Dieser Film, der die Lebensbedingungen der Arbeiter in der Zeit der Weltwirtschaftskrise veranschaulicht, gilt auch heute noch als einer der bedeutendsten kommunistisch-proletarischen Filme Deutschlands. Im Exil arbeitete Brecht mit Fritz Lang zusammen und unterstützte ihn beim Drehbuch für den Film "Auch Henker sterben" (1943). Zurück in Berlin bemühte er sich bei der DEFA um die Verfilmung einiger seiner Werke wie zum Beispiel "Mutter Courage", scheiterte aber mit seinen Vorstellungen an der ablehnenden Haltung der DEFA. Zwei Jahre nach seinem Auszug aus Weißensee nach Mitte starb Bertolt Brecht.
8. Lichtspiele Schloss Weißensee/ Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel
Berliner Allee 125, 13088 Berlin
Schon 1877 fuhr die Straßenbahn vom Alexanderplatz Richtung Weißensee. Damals noch als Pferdetram mit der "Neuen Berliner Pferdebahn-Gesellschaft". Endstation: Schloss Weißensee. Das Schloss am Südufer des Sees war aber kein Sitz von Fürsten oder Königen, sondern eine Vergnügungsstätte. Als "Welt-Etablissement Schloss Weißensee" lockte es ab 1885 die Massen mit Attraktionen wie einem Vergnügungspark mit Seeterrasse, Rutschbahn, Musikpavillon, Würfelbuden, Karussells. Natürlich gehörten auch Tanzsäle und verschiedene Bierlokale dazu. Zur Berliner Allee hin befand sich ein Brauereibetrieb mit kleinem und großem Festsaal. 1927 wurde der große Festsaal dann zum Kino umgestaltet. "Lichtspiele Schloss Weißensee" war sein Name.
In dieser Zeit existierten in Weißensee schon einige andere Kinos. Häufig wurden schlechtgehende Geschäfte mit Stühlen ausgestattet und so zu mehr oder wenig ertragreichen Kinematographentheatern. Die Lichtspiele Schloss Weißensee waren zwar auch kein eigenständiger Kinobau wie das Kino Toni oder das Delphi. Aber nach einer Erweiterung 1929 mit 1.550 Plätzen war es das größte Kino in Weißensee. Bis in die 1950er Jahre wurde der Saal als Kino genutzt. Das ehemalige Brauereigebäude hat in dieser Zeit verschiedene Nutzungen erfahren. Ab den 1970er Jahren war es das "Kulturhaus Weißensee" und trug später den Namen des Schriftstellers Peter Edel. Nach einigen Jahren des Leerstands erfolgte 2020 die Wiedereröffnung als Bildungs- und Kulturzentrum Peter Edel unter dem Trägerverein "Kommunales Bildungswerk e. V.". Der ehemalige Kinosaal wurde unter Beachtung seines historischen Charakters aufwändig restauriert. Dabei wurden neobarocke Stuckelemente wieder sichtbar und alte Wanddekore aufgearbeitet. Heute finden im Festsaal große Tanz- und Musikveranstaltungen statt.
9. Woelckpromenade
Woelckpromenade 7, 13086 Berlin
Das Gebäudeensemble in der Woelckpromenade ist Teil des sogenannten Munizipalviertels von Weißensee. Ihren Namen verdankt die Straße dem ehemaligen Bürgermeister Carl Woelck. Er setzte sich Anfang des 20. Jahrhunderts für den urbanen Ausbau Weißensees ein. Sein Ziel war, für Weißensee Stadtrecht zu erlangen. Rund um den Kreuzpfuhl ließ er seinen Gemeindebaurat Carl James Büring das neue Ortszentrum mit Schule, Stadthalle, Pumpwerk und Wohnhäusern bauen. Orientiert an märkischer Backsteinarchitektur, sollte ein Wohnviertel für gehobene Ansprüche realisiert werden. Mit seinen großen Plänen für eine selbstständige Stadt Weißensee konnte sich Woelck aber nicht durchsetzen. 1920 wurde Weißensee in Groß-Berlin eingemeindet. Die Gebäude des Munizipalviertels stehen aber als Zeugnis für diese besonderen Ambitionen und gehören zu den architektonischen Highlights von Weißensee. Die Gebäude in der Woelckpromenade stehen unter Denkmalschutz.
Allerdings fällt eines aus der Reihe: das "Geisterhaus" in der Nummer 7. Seit den 2010er Jahren steht es leer. Von diesem Zustand und der idyllischen Umgebung profitierten bereits verschiedene Filme und Serien. In Staffel 3 und 4 der Erfolgsserie "Babylon Berlin" wohnt Hauptfigur Gereon Rath, gespielt von Volker Bruch, in der Woelckpromenade. Zunächst noch mit seiner Schwägerin und Geliebten Helga, zieht in Staffel 4 seine Kollegin Charlotte Ritter ein. Für die Dreharbeiten musste die komplette Straße gesperrt werden, da vor der Tür diverse Oldtimer positioniert wurden. Für eine weitere Szene nutzte die Produktionsfirma X-Filme auch den Bereich rund um die Primo-Levi-Schule. In einer Nachtszene wird Rudi Malzig, Assistent des Gerichtsmediziners Dr. Schwarz, ermordet. Dafür wurde das ganze Viertel aufwändig ausgeleuchtet und Nebelmaschinen sorgten für eine geheimnisvoll-bedrohliche Stimmung. Eine weitere Serie, die die gut erhaltenen Backsteingebäude als Kulisse nutzte, ist "Deutschland 89". Es ist die dritte Staffel einer Serie über einen ehemaligen Grenzsoldaten, Martin Rauch, der von der Staatssicherheit als Spion in die BRD eingeschleust wird. Da die Szene in Frankfurt spielen soll, tragen die Autos in der Straße Frankfurter Nummernzeichen. In der fertigen Szene sieht man zudem im Hintergrund mehrere große Bürotürme, die in der Postproduktion am Computer ergänzt wurden und die Frankfurter Skyline darstellen sollen.
10. Kino Toni
Antonplatz 1, 13086 Berlin
"Heut geh’n wir in den Kintopp", so hieß es auch in Weißensee. Nachdem es schon einige kleinere Ladenkinos gab, folgte 1919 erstmals ein eigener Kinobau: die "Decla-Lichtspiele". Die Decla war damals nach der UFA die zweitgrößte deutsche Filmgesellschaft, hatte ihr Atelier in der Liebermannstraße in Weißensee und betrieb eine eigene Kinokette. Das Kino am Antonplatz entstand als ein "Wohnhaus mit Lichtspieltheater" und war mit 700 Plätzen zur Eröffnung sogleich das größte Kino in Weißensee. Verantwortlich für den Bau waren die Architekten Fritz Wilms und Max Bischoff . Vor allem Fritz Wilms war in der Zeit der Weimarer Republik der wichtigste Kino-Architekt in Berlin und baute unter anderem das Alhambra in Charlottenburg, das Colosseum im Prenzlauer Berg, den Mercedes-Palast in Neukölln und den Turmpalast in Moabit. Zwei Jahre nach der Eröffnung änderte das Kino nach der Fusion der Decla mit der UFA seinen Namen in UFA-Kino. Ende der 1920er Jahre folgte die technische Umstellung vom Stummfilm- zum Tonfilmkino. Nach dem Zweiten Weltkrieg blieb das Kino in Betrieb und erhielt 1948 den Namen "Toni Film-Bühne" – in Anlehnung an den Antonplatz, den "Toni".
Nach verschieden Umbauarbeiten und Krisen übernahm 1992 der Regisseur Dr. Michael Verhoeven die Leitung des Kinos. In seiner Zeit fand auch die Aufteilung in zwei Säle statt. Das Kino "Toni" hatte nun einen großen Saal (Toni) und einen kleinen Saal (Tonino). Heutiger Betreiber ist der unabhängige Berliner Verleih Neue Visionen, der auch für zwei andere Traditionskinos, das Moviemento und das Central, verantwortlich ist. Das Kino bemüht sich in seiner Programmgestaltung vor allem um Familien mit Kindern. Beliebt ist das Kino auch wegen seines Filmclubs und des Berliner Filmmontags, zu dem regelmäßig bekannte Gäste eingeladen werden. Heute gehört das "Toni" zu den ältesten Kinos der Stadt mit fast durchgehendem Betrieb seit der Gründung vor inzwischen mehr als 100 Jahren.
11. Theater im Delphi
Gustav-Adolf-Straße 2, 13086 Berlin
"Tonfilm ist Kitsch! Fordert gute stumme Filme! Wer Kunst und Künstler liebt, lehnt den Tonfilm ab!" Dieser Appell der Berufsverbände der Artisten und Musiker scheint in Weißensee erhört worden zu sein. Denn am 26. November 1929 eröffnete hier das Stummfilmkino "Delphi", als der Tonfilm sich längst auf der Überholspur befand. Aber es war das letzte seiner Art in Berlin. Von außen ist das nach den Plänen der Architekten Julius Krost und Heinrich Zindel erbaute Gebäude eher nüchtern. Der abweisende, fast fensterlose Bau, dessen verputzte Fassade leicht vor sich hin bröckelt, zieht kaum jemanden von der Straße hinein. Zur Eröffnung existierte über den drei gläsernen Eingangstüren noch eine große Werbefläche für die Filme und darüber ein schräg ansteigender Neonschriftzug "Delphi". Seitlich der Werbefläche befanden sich pyramidisch abgestufte Neonröhren. Das reduzierte Äußere lässt es nicht vermuten, aber innen wird es spektakulär: Unter einem Tonnengewölbe umfassen drei muschelförmige Stuckbögen die Bühne wie eine Grotte. Sie werden seitlich mit hinter den Bögen verborgenen Glühbirnen erleuchtet.
Früher konnte das "Delphi" fast 1.000 Personen aufnehmen – dicht gedrängt unten in der "Holzklasse", etwas geräumiger oben auf den Logenplätzen oder dem Rang. Natürlich gab es auch einen Orchestergraben Allerdings war das Delphi nur ein paar Monate Stummfilmkino und kämpfte sich dann als Tonfilmkino durch das folgende Jahrzehnt. Auch nach 1945 ging es zunächst weiter, bis Ende der 1950er Jahre. Danach wurde das Gebäude als Gemüselager, Wäschereistützpunkt, Briefmarkengeschäft oder Schauraum für Orgelbau genutzt.
Heute ist das ehemalige Kino ein öffentlicher Kulturort. Dank der Initiative des Künstlers Nikolaus Schneider und einer Schweizer Stiftung stehen Theater, Tanz, Oper, Konzert, Performance, Film und viele Hybrid-Projekte auf dem Programm. Das Innere ist heute überwiegend noch original und lässt den Charme des vorigen Jahrhunderts erahnen. Einer breiten Öffentlichkeit bekannt wurde das Delphi durch die Serie Babylon Berlin. Die Serie nutzt den Saal als Drehort für das verruchte Nacht-Etablissement "Moka Efti". Auf der Bühne tritt in der ersten Staffel die Sängerin Swetlana Sorokina, gespielt von Severija Janušauskaite, auf und singt den Erfolgshit "Zu Asche, zu Staub". In der vierten Staffel wird hier ein Tanzmarathon ausgetragen, bei dem die Tänzerinnen so lange tanzen, bis nur noch eine übrig geblieben ist.
12. Caligari-Platz
Caligari-Platz, 13086 Berlin
"Du musst Caligari werden". Überall in Deutschland konnte man diesen rätselhaften Satz lesen. Es war die Werbekampagne für den Stummfilm "Das Cabinet des Dr. Caligari" (1921) von Robert Wiene. Und diese Werbung funktionierte hervorragend. Der Film um den ominösen Doktor Caligari und sein Geschöpf Cesare, gespielt von Werner Krauß und Conrad Veidt, traf den Nerv der Zeit. Ein Schausteller, der sich eines Schlafwandlers bedient und ihn nachts als Mörder durch die Straßen der Stadt ziehen lässt: ein Horrorfilm. Der Film gilt nicht nur als ein Schlüsselfilm der Weimarer Zeit. Er ist einer der wichtigsten Filme der Filmgeschichte überhaupt, der inhaltlich und stilistisch bis heute Einfluss hat. Der bis dahin namenlose Platz erinnert seit 2002 an den größten Filmerfolg aus "Klein-Hollywood". Gedreht wurde allerdings nicht hier, sondern etwa drei Kilometer entfernt in den heute nicht mehr existierenden Lixie-Ateliers in der Liebermannstraße, der Filmatelier-Straße von Weißensee. Der Film wurde als der erste expressionistische Film Deutschlands beworben. Seinen besonderen Stil ist vor allem dem Bühnenbild geschuldet. Die Künstlichkeit der aufgemalten Kulissen, die indirekte Beleuchtung, das ständige Spiel von Licht und Schatten, extreme Bildperspektiven und Kamerastandpunkte erzeugten eine Atmosphäre, wie sie bisher in keinem deutschen Film zu sehen war. Die Wände stehen schief, Fenster sind meistens dreieckig, die engen Gassen der Kleinstadt scheinen jeden Moment in sich zusammenzufallen: albtraumhaft, klaustrophobisch wirkt das.
Die Namensgebung des Platzes ist dem Verein "Glashaus – Verein der Nutzer der Brotfabrik" zu verdanken. Die Brotfabrik hatte einen neuen Haupteingang, der auf den namenlosen Platz führte. So kamen zwei Bedürfnisse zusammen: eine Adresse und eine Würdigung des Filmklassikers. 2002 konnten dann die insgesamt fünf Straßenschilder aufgestellt wurden.
13. Brotfabrik
Caligari-Platz 1, 13086 Berlin
Die Brotfabrik am Caligari-Platz führt die fast verschwundene Tradition von Weißensee als Film- und Kinostandort fort. Die einst zahlreichen Kinos waren in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach und nach geschlossen worden. Am damals noch namenlosen Platz an der Prenzlauer Promenade entstand im Mai 1990 dagegen noch vor der Wiedervereinigung ein neues Kino. Es war zwar klein mit nur 55 Plätzen, erlangte aber dennoch Bekanntheit, weil es das erste Ost-Berliner Programmkino war. Der Name "Brotfabrik" bezieht sich auf die Geschichte des Gebäudes. Während die Einrichtung von Kinos in Brauereien oder Gasthäusern in ganz Berlin geläufig war, befindet sich das Kino hier in den ehemaligen Backräumen einer Bäckerei. Allerdings ist es lange her, dass hier letztmals Kuchen gebacken wurde. 1890 hatte sich der Bäckermeister Michael Kohler in der damals noch sehr ländlichen Gegend niedergelassen. Mehrmals wurde die Bäckerei erweitert. 1929 entstanden die Räume für die Kuchenherstellung – der Standort des heutigen Kinos. Die Geschichte der Bäckerei endete 1952 mit der Flucht der Bäckersfamilie in den Westen. Danach erfuhr das Gebäude die unterschiedlichste Nutzungen, bis 1986 der Jugendclub der Kunsthochschule Weißensee einzog. 1990 erfolgte eine Umstrukturierung, das Kulturzentrum Brotfabrik entstand und nahm die Kinotradition wieder auf.
Auf dem Platz vor dem Kino, seit 2002 Caligari-Platz, kann man im Sommer dank der "BrotfabrikKneipe" essen und trinken. Aber auch die Innenräume der Kneipe lohnen eine ausführliche Begutachtung. Die originale Wandbemalung und das Parkett aus der Zeit, als hier um 1900 noch ein Gasthaus war, sind teilweise erhalten.
FLYER „Von Klein Hollywood nach Babylon Berlin“ - Reise durch die Filmstadt Weißensee - DOWNLOAD
Thementour – "Pankow im DEFA-Film"
Tauchen Sie ein in die faszinierende Welt des DEFA-Films, wo der Prenzlauer Berg als perfekter Drehort galt, um authentische Geschichten zu erzählen.
Die Deutsche Film AG, kurz DEFA, war das volkseigene Filmstudio der DDR. In den Jahren von Mai 1946 bis Mai 1992 wurden durch die DEFA rund 700 Spielfilme gedreht, 750 Animationsfilme sowie 2.250 Dokumentar- und Kurzfilme.
DEFA-Klassiker wie „Berlin Ecke Schönhauser“ oder „Solo Sunny“ haben den Bezirk Pankow weit über die Grenzen des Landes berühmt gemacht. Aber es sind längst nicht die einzigen Filme, die während der DDR-Zeit „on location“ in Pankow entstanden: Wenn DDR-Filmemacher möglichst lebensnah von Lebenskünstlern, Tagträumern und sonstigen schrägen oder unangepassten Typen erzählen wollten, war für sie vor allem der Prenzlauer Berg der favorisierte Drehort.
Besonders faszinierend sind die heute oft übersehenen DEFA-Spielfilme aus den Jahren 1965/66, die lange Zeit in den Archiven der SED-Führung verbannt waren und erst nach dem Mauerfall ans Licht kamen. Diese „Kellerfilme“ zeigen auf beeindruckende Weise die Vielfalt und Lebendigkeit des Alltags in der DDR, und das obwohl meist in Schwarz-Weiß gedreht.
Tourenüberblick
Start: S-Bhf. Storkower Straße
Ziel: Carl-von-Ossietzky-Gymnasium
Görschstr. 42/44, 13187 Berlin
Länge: ca. 13,7 km
Fahrzeit: ca. 1 Stunde
Orte der Thementour
1. Die Beunruhigung (1982)
S-Bahnhof Storkower Straße
Regie: Lothar Warneke
Drehbuch: Lothar Warneke
Darsteller: Christine Schorn (Inge Herold), Hermann Beyer (Dieter Schramm), Mike Lepke (Sohn), Cox Habbema (Brigitte)
Was tut eine Frau Mitte Dreißig, die unerwartet eine Brustkrebsdiagnose erhält? In einer langen Rückblende erzählt der Film von Lothar Warneke, wie die Psychologin Inge Herold (Christine Schorn) die 24 Stunden zwischen Verdachtsdiagnose und OP nutzt, um ihr bisheriges Leben zu überdenken. In authentischen und einfühlsamen Bildern erzählt der Frauenfilm, wie eine Psychologin mit der Verdachtsdiagnose Krebs umgeht und ihr bisheriges Leben überdenkt. Eine entscheidende Szene spielt am S-Bahnhof Storkower Straße. Hier trifft sie ihren Jugendfreund und fragt ihn geradeheraus, was er tun würde, wenn er erfahren müsste, dass er nicht mehr lange zu leben hat. „Am Leben kleben“, antwortet er spontan. Der Film wurde als einzige Low-Budget-Produktion, die die DEFA jemals produzierte, national vielfach ausgezeichnet und auch international beachtet.
2. Mein lieber Robinson (1971)
Volkspark Prenzlauer Berg, 10407 Berlin
Regie: Roland Gräf
Kamera: Roland Gräf
Darsteller: Jan Bereska (Peter / Robinson), Gabriele Simon (Karin), Alfred Müller (Vater Gruner), Dieter Franke (Adam Kowalski), Karin Gregorek (Barbara), Käthe Reichel (Karins Wirtin)
Der junge Peter, genannt „Robinson“, bereitet sich auf sein Medizinstudium vor. Dabei ist er ein Träumer, der mehr in der Phantasie als in der Realität lebt. Die Begegnung mit der Studentin Karin bringt ihn aus der Fassung. Als Karin ungewollt schwanger wird, macht dem 19-jährigen die Vorstellung zu schaffen, wie er seinem eigenen Vater von der Schwangerschaft bzw. dem Enkelkind erzählen soll. So vergeht fast ein Jahr, bis Robinson endlich einen Weg findet, seinem Vater klarzumachen, dass der nun einen Enkel hat. Hier im Volkspark Prenzlauer Berg sieht man den jungen Robinson, wie er mit seinem frisch geborenen Kind spazieren geht.
Es sind scheinbar spontane, trotzdem zauberhafte Momentaufnahmen, mit denen Kameramann Roland Gräf in seinem Regie-Debüt den Kiez-Alltag Anfang der 1970er Jahre einfängt, zumeist in Schwarz-Weiß. Mit seiner jungenhaften, frischen Präsenz war „Mein lieber Robinson“ der zweite Film, in dem der talentierte Jan Bereska gemeinsam mit dem populären Alfred Müller vor der Kamera stand. Allerdings galt er zu dem Zeitpunkt bereits als schwieriger, „oppositioneller Jugendlicher“, so dass er danach nur noch wenige Gelegenheiten erhielt, in weiteren DEFA-Filmen besetzt zu werden.
3. Bis dass der Tod euch scheidet (1979)
Greifswalder Straße (neue Wohnung), Greifswalder Straße/ Ecke Storkower Straße (alte Wohnung)
Regie: Heiner Carow
Drehbuch: Günther Rücker
Darsteller: Katrin Sass (Sonja), Martin Seifert (Jens), Angelica Domröse (Jens Schwester), Renate Krößner (Tilli), Werner Godemann (Brigadier), Horst Schulze (Verkaufsstellenleiter)
Sonja liebt Jens und will am Hochzeitstag von ihm hören, dass auch er sie liebt und dass er immer lieb zu ihr sein wird. Das ist das Eheversprechen, das ihr wichtig ist. Es folgen Szenen einer Ehe aus dem Prenzlauer Berg in den 1970er Jahren, die nur zu ertragen sind, weil sie so intensiv und rigoros gespielt werden. Die noch blutjunge Katrin Sass gibt in ihrem Debütfilm alles, was eine naive, gut meinende Frau geben kann, die „alles richtig machen“ möchte. An ihrer Seite schafft ein großartiger Martin Seifert das Kunststück, dass man beim Zuschauen mit ihm fühlt, und ihn gleichzeitig verprügeln
will.
An der Greifswalder Straße befindet sich die neue, helle Wohnung mit Balkon und Aussicht auf den neuen Fernsehturm, während das erste gemeinsame Heim ein Altbau an der Greifswalder Straße / Ecke Storkower Straße war.
4. Der Kinnhaken (1962)
Naugarder Straße 39, 10409 Berlin
Regie: Heinz Thiel
Drehbuch: Manfred Krug
Darsteller: Manfred Krug (Georg Nikolaus), Dietlinde Greiff (Carolin Merzen), Marita Böhme (Rose), Jürgen Frohriep (Bubi), Erik S. Klein (Frank Hübner)
Morgens um sieben bricht für die junge Carolin ihre Welt auseinander: Es ist der 13. August 1961, als sie aus den Radio-Nachrichten erfährt, dass sie nicht mehr raus kann aus Ost-Berlin, wo sie lebt, um in den Westteil der Stadt zu kommen, wo sie bisher in einer Bar gearbeitet hat. Auch der Flirt mit dem Wachsoldaten Georg Nikolaus nützt wenig. Statt ihr einen Tipp zu geben, wo noch „ein Loch in der Mauer“ zu finden wäre, vertröstet er sie auf später. Plakativ und durchschaubar wirkt der ganze, offenbar schnell gemachte „Mauerfilm“. Nicht nur die Liebesgeschichte taugt nur schwach zur Rechtfertigung des Mauerbaus. Auch wird die „Sehnsucht nach dem Westen“ als dumm oder egoistisch deklassiert. Dabei war ausgerechnet Manfred Krug an dem Drehbuch beteiligt. Nach der Filmpremiere lobte ihn die Wochenpost für seinen „rauen Charme“, vor allem aber, dass er „in jenen Tagen die Mühe und das Risiko eines Drehbuchanfängers auf sich nahm“, um seinen Altersgenossen zu sagen, dass „es sich hier besser und menschlicher leben“ ließ.
Ironie des Schicksals: Der wohl populärste Schauspieler der DDR, der zwei Jahrzehnte lang in drei bis vier DEFA-Filme pro Jahr spielte, kehrte 1977 der DDR den Rücken, aus Protest auf die Ausweisung des Liedermachers Wolf Biermann. Fast übergangslos startete er danach im Westen eine zweite, erfolgreiche Karriere als Fernsehserien-Star. Die gebürtige Pankowerin Dietlinde Greiff, die in diesem Film ihr Hauptrollen-Debut gab, verließ schon 1968 das Land – um einen Schweizer zu heiraten.
5. Fräulein Schmetterling (1965–1966 / 2020)
Angermünder Straße 10, 10119 Berlin
Regie: Kurt Barthel
Drehbuch: Christa und Gerhard Wolf
Darsteller: Melania Jakubisková (Helene), Christina Heiser (Asta), Carola Braunbock (Tante), Milan Sládek (Pantomime), Herwart Grosse (Kubinke, Busfahrer), Rolf Hoppe (Vorsteher Jugendfürsorge, Herr Himmelblau), Lissy Tempelhof (Mitarbeiterin Jugendfürsorge, Frau Fertig)
Immer wieder tagträumt sich die 18-jährige Helene Raupe in eine alternative, sonnenblumige Welt. Da reicht schon ein kaputter Schirm, den sie hier in der Angermünder Straße findet, damit aus ihr „Fräulein Schmetterling“ wird – und sie für einen kurzen Moment fliegen lernt. Wer mit heutigen Augen den 1965 gedrehten Film schaut, kann nur staunen, über die zauberhaft-frischen und oft dokumentarischen, schwarz-weißen Bilder. Einige Szenen – wie das magische Schmetterlings-Intro – entstanden in Pankow. Der Film wurde in der DDR verboten. Das Drehbuch des Ehepaars Christa und Gerhard Wolf, mit dem Kurt Barthel befreundet war, hatte „der Prüfung auf politisch-ideologische Fehler“ nicht genügt. Erst 2019/2020 wurde er in einer rekonstruierten Fassung veröffentlicht, wie von Regisseur Kurt Barthel in seinem Regie-Debüt ursprünglich intendiert.
6. Jahrgang 45 (1966 / 1990)
Teutoburger Platz / Ecke Christinenstraße, 10119 Berlin
Regie: Jürgen Böttcher
Kamera: Roland Gräf
Darsteller: Rolf Römer (Alfred, genannt Al), Monika Hildebrand (Lisa, genannt Li), A.R.Penck (Freund), Gesine Rosenberg (Rita)
Auf der Suche nach mehr Sinn fürs Leben, lässt sich der junge Al, „Jahrgang 45“ (1966) einen Sommer lang durch die Gegend rund um den Teutoburger Platz treiben. Während die halbe Stadt, das ganze Land zum spürbaren Aufschwung ausholt, gibt sich Al (Rolf Römer) in seiner lässigen Lederjacke entspannt und unbeteiligt. Meist gelangweilt, lässt er sich durch die lauen Sommertage und -nächte treiben, manchmal auch zusammen mit seinem Künstlerkumpel A.R. Penck (der sich selbst spielt). Dazwischen hört er Jazz von alten Platten oder Radio, wo gerade Eva-Maria Hagen zur Gitarre von Wolf Biermann singt. Statt einer sich entwickelnden Story, fängt der Schwarz-Weiß-Film ein vages Lebensgefühl ein: Aus der Perspektive eines Suchenden erzählt der Film sehr authentisch von einer kurzen Sommer-Zwischenzeit, in der alles offen und möglich
erscheint.
Zusammen mit Kameramann Roland Gräfe fand Dokumentarfilmer und Maler Jürgen Böttcher für seinen ersten und einzigen Spielfilm sehr ruhige, lange Einstellungen rund um den Teutoburger Platz, die unaufdringlich, fast beiläufig den Alltag festhalten. Der Film war den staatlichen Filmprüfern nicht geheuer und sie verbannten deshalb das Rohmaterial beim berüchtigten XI. Plenum des ZK als „Kellerfilm“ in die Archive. Die Uraufführung fand erst nach der Wende, 1990 im Kino Babylon statt.
7. Königskinder (1962)
Christinenstraße / Ecke Lottumstraße, 10119 Berlin
Regie: Frank Beyer
Darsteller: Annekathrin Bürger (Magdalena), Armin Mueller-Stahl (Michael), Ulrich Thein (Jürgen), Manfred Krug (Oberleutnant)
Schon als dieser Film über „Liebe, Freundschaft und Verrat in Zeiten des Nationalsozialismus Berlin der 1930er Jahre“ 1962 in die Kinos kam, ließ er die „ganz große Zugkraft an den Kinokassen“ vermissen. Die „Königskinder“: Magdalena
und Michael, die sich seit Kindertagen kennen, können als Paar nicht zusammenkommen, weil die Nazis die Macht ergreifen.Ihre unverbrüchliche Liebe opfern sie stattdessen dem antifaschistischen Kampf. Aus heutiger Sicht trieft Frank Beyers antifaschistischer Film nur so vor Belehrungen über den richtigen, aufrechten Weg. In großen Teilen basierend auf wahren Erlebnissen des Schriftstellers Walter Gorrish (1909–1981), erzählt das Melodram dabei in vielen, ineinander verschachtelten Rückblenden von der Liebe bzw. ihrer Unmöglichkeit in politisch gefährlichen Zeiten.
Gedreht wurde überwiegend in Dresden, der Sächsischen Schweiz und in den DEFA-Studios. Nur wenige Außenaufnahmen entstanden im Kollwitz-Kiez, zum Beispiel hier in der Christinenstraße. Getrieben von einem Steckbrief, der nach ihm fahndet, eilt Michael Richtung Lottumstraße. Unerwartet ist der Auftritt von Publikumsliebling Manfred Krug: Als skrupelloser Oberleutnant zwingt er das Strafbataillon zu standrechtlichen Erschießungen.
8. Die Legende von Paul und Paula (1973)
Kastanienallee 7–9 (Prater), 10435 Berlin
Regie: Heiner Carow
Drehbuch: Ulrich Plenzdorf
Darsteller: Angelica Domröse (Paula), Winfried Glatzeder (Paul)
Kein anderer erfolgreicher DEFA-Film wurde in Ost und West so unterschiedlich wahrgenommen wie „Die Legende von Paul & Paula“: Während der romantische Liebesfilm bis zum Mauerfall im Westen kaum Beachtung fand, wurde er im Osten der Republik schnell zum Kassenschlager, dann zum Kultfilm und schließlich sogar zum Lieblingsfilm von Angela Merkel. Diese Diskrepanz wurde oft damit begründet, dass der Film verklausulierte Botschaften transportierte, die in Westdeutschland niemand so richtig verstand.
Erstmals nach einer langen Phase der Stagnation kam mit Heiner Carows poetischen Romanze 1973 ein Film in die Kinos, der mit lebensnahen Figuren und Dialogen wirkte, wie mitten aus dem DDR-Alltag. Dazu begleiten die „Puhdys“ die Handlung mit eigens für den Film produzierten Songs.
Lebensnahe Dialoge und eine poetisch-märchenhafte Stimmung machten „Die Legende von Paul & Paula“ zum populärsten DEFAFilm aller Zeiten, im „Prater“ kamen auch noch magische Lichtspiele dazu. Hier im „Prater“ treffen Paul & Paula erstmals aufeinander. Dabei lockt der Rummel mit magischen Lichtspielen, wirbelnder Lebenslust und mit einer märchenhaften Botschaft.
Gedreht wurde an verschiedenen Orten in Pankow: Bevor Paul Paula kennenlernt, heiratet er in der Gethsemanekirche Ines, die Tochter eines Schießbudenbesitzers. Im „Prater“, treffen Paul & Paula erstmals aufeinander, dabei lockt der Rummel mit magischen Lichtspielen und wirbelnder Lebenslust.
9. Berlin Ecke Schönhauser (1957)
U-Bahnhof Eberswalder Straße, 10437 Berlin
Regie: Gerhard Klein
Drehbuch: Wolfgang Kohlhaase
Darsteller: Ekkehard Schall (Dieter), Ilse Pagé (Angela), Harry Engel (Karl-Heinz), Ernst-Georg Schwill (Kohle)
Noch ist die Berliner Mauer nicht gebaut. Noch hat die Jugend der jungen DDR die Wahl, wo sie leben möchte und wie. 1957, wenige Jahre nach Kriegsende, fehlt es im neuen Deutschland an Geld, Lehrstellen, Wohnungen, besonders aber an Vätern, Vorbildern und an Perspektiven. So haben die heranwachsenden Jungs, die rund um die Hochbahn am Bahnhof Schönhauser Straße zumeist beengt leben, nicht viel mehr zu tun, als sich „an der Ecke“ zu treffen und die Zeit totzuschlagen. Im Stil des italienischen Neorealismus gedreht, erzählt der Film eine düstere Geschichte in schattigen schwarz-weißen Bildern.
Die 2. Filmkonferenz der SED befand 1958, dass der Film „die Ostberliner Jugend zu negativ darstellt“. Außerdem wurde moniert, dass für die einzige weibliche Rolle die West-Berlinerin Ilse Pagé engagiert wurde, wofür sie 5.000 Valuta-Mark als Honorar erhielt. Das drohende Verbot konnte allein durch eine positive Einschätzung der FDJ-Vertretung verhindert werden, heißt es. So konnte, glücklicherweise, auch der dritte Prenzlauer-Berg-Film des sehr erfolgreichen Nationalpreisträger-Gespanns Wolfgang Kohlhaase (Drehbuchautor) und Gerhard Klein (Regie) mit drei Monaten Verspätung in den Kinos anlaufen und sogar zum Klassiker werden.
10. Leben zu zweit (1967)
Schönhauser Allee / Ecke Milastraße, 10437 Berlin (Wohnung)
Regie: Hermann Zschoche
Kamera: Roland Gräf
Darsteller: Marita Böhme (Karin Werner), Alfred Müller (Peter Freund), Evelyn Opoczynski (Nora Werner), Jan Bereska (Mark), Hanns-Michael Schmidt (Sascha)
Es entbehrt nicht einer gewissen Ironie, dass ausgerechnet eine Standesbeamtin in Panik gerät, als sie einen Heiratsantrag bekommt. Immer wieder findet Karin jedenfalls neue Ausflüchte, warum ihr Liebhaber ihre Tochter Nora nicht kennenlernen soll. Dabei hat die Teenager-Tochter, gerade 16 geworden, längst geschnallt, dass ihre Mutter jemanden trifft. Und dazu ist sie selbst verliebt bis über beide Ohren. Durch die parallele, gleichzeitig miteinander verwobene Verliebtheitserfahrung von Mutter und Tochter erzählt der Film im leichten, ironischen Ton vom Wesen der Liebe, und wie es sich mit den Jahren und Erfahrungen insbesondere für die Frauen verändert.
Hier in der Milastraße / Ecke Schönhauser Allee befand sich die große Altbauwohnung von Karin mit Balkon. Zudem gibt es in Pankow gedrehte Impressionen, als die Kamera von Roland Gräf den Protagonisten in einem offenen Käfer-Cabrio durch die Haupt- und Nebenstraßen von Pankow folgt – sei es durch die Cantianstraße oder auch durch die Milastraße.
11. Solo Sunny
Kopenhagener Straße, S-Bahn-Brücke Dänenstraße (Fußgängerbrücke)
Regie: Konrad Wolf
Drehbuch: Wolfgang Kohlhaase
Darsteller: Renate Krößner (Ingrid „Sunny“ Sommer), Alexander Lang (Ralph), Heide Kipp (Freundin Christine), Dieter Montag (Harry), Klaus Brasch (Norbert)
Hinfallen, aufstehen, weitermachen und niemals aufgeben: Für ihren Traum von Glück und Anerkennung kämpft sich „Solo Sunny“ durchs Leben, allen Widrigkeiten und Niederlagen zum Trotz. Sunny heißt eigentlich Ingrid Sommer, ist Anfang Zwanzig, ehemalige Schlosserin und tingelt als Frontsängerin einer Musiker-gruppe über die Dörfer Brandenburgs, um sich ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Vermutlich hätte kein anderer als der in der DDR hochgeschätzte Konrad Wolf, diese leichte und gleichermaßen gesellschaftskritische Geschichte verfilmen können. Der für seine Vergangenheitsbewältigung gefeierte Regisseur lässt im Gegenlicht zu Sunny anhand verschiedener Personen unterschiedliche Lebensentwürfe des real existierenden Sozialismus quasi Revue passieren. Mit Wolfgang Kohlhaase als Drehbuchautor und Co-Regisseur an seiner Seite sowie mit dem jungen, bis dahin unbekannten Dokumentarfilmer Eberhard Geick als Kameramann, gelang ein stimmiger Film, der Sunnys frecher, ungezwungener Art auch in unkonventionellen Einstellungen folgt. Auch optisch wird dabei nichts verschönt an den unsanierten, kohleofen-grauen Straßenzügen des Prenzlauer Bergs dieser Zeit. Hier in der Kopenhagener Straße 13 befindet sich im Film Sunnys Wohnung.
Das „Lexikon des internationalen Films“ lobt den Film als „mutiges Plädoyer gegen gesellschaftliche Bevormundung, für Individualität und den eigenen Weg durchs Leben“. Kritiker und Publikum sahen das wohl gleichermaßen: Bei der Berlinale 1980 erhielt Renate Krößner einen Silbernen Bären als beste Darstellerin. Beim Nationalen Spielfilmfestival in Karl-Marx-Stadt räumten Renate Krößner, Heide Kipp, Dieter Montag sowie Regie, Drehbuch, Szenenbild und Schnitt alle Preise ihrer Klasse ab.
12. Die Kuckucks (1949)
Berliner Straße, 13189 Berlin
Regie: Hans Deppe
Drehbuch: Robert A. Stemmle, Marta Moyland
Darsteller: Ina Halley (Inge), Hans Neie (Rolf), Karl-Heinz Schröder (Max), Nils Peter Mahlau (Moritz), Regine Fischer (Evchen), Günther Güssefeldt (Heinz Krüger), Aribert Wäscher (Eberhard Schultz), Rainer Penkert (Hans Gersdorf)
Im Nachkriegsberlin sind die fünf Kuckert-Kinder auf sich gestellt. Oft müssen sie umziehen, weil kein Vermieter sie lange behalten will. Dann finden „Die Kuckucks“ ein neues Zuhause in einer kriegszerstörten Villa, die nur noch etwas renoviert werden muss. Das „heitere Trümmer-Märchen mit ernstem Hintergrund“ kam im April 1949 in die Kinos – da gab es die DDR noch nicht und auch die DEFA erst wenige Monate. Zwischen den Trümmern wurde einfach gedreht – u.a. in der Berliner Straße in Pankow, wie im Drehprotokoll notiert, aber heute nicht mehr ganz eindeutig nachvollziehbar. Es wird eine jener Straßenszenen gewesen sein, in der die fünf Kinder mal wieder umziehen, samt vollgepacktem Bollerwagen. Nicht nur was die Frisuren der Frauen und den Schnitt der Herrenanzüge betrifft, wirkt der Schwarz-Weiß-Film wie aus heiteren Vorkriegstagen. Inszeniert von Regisseur Hans Deppe – später berühmt als „König des Heimatfilms“ – werden in dieser Kindergeschichte ernsthafte Probleme konsequent ausgeblendet oder mit fröhlich pfeifenden Musikeinlagen übertüncht.
13. Coming out (1989)
Görschstraße 42/44, 13187 Berlin (Carl-von-Ossietzky-Gymnasium)
Regie: Heiner Carow
Darsteller: Matthias Freihof (Philipp), Dagmar Manzel (Tanja), Dirk Kummer (Matthias), Michael Gwisdek (Achim)
Die letzte Szene des Films ist lang und fast stumm, dafür maximal angespannt: Was wird der junge Klassenlehrer Philipp tun, wie wird er die „gewissen Vorkommnisse“ erklären? Schüler und Kollegium trieb die Frage um: Stimmten die Gerüchte, dass er schwul war? Als nach drei unendlichen, untätigen Minuten die Antwort kommt, ist es ein echtes „Coming out“, kurz, trotzig und befreiend: „Ja“. In den zwei Stunden zuvor erzählt der Film wie er an der neuen Schule mit Tanja, einer ehemaligen Mitschülerin und nun Kollegin, zusammentrifft. Wie sie ihn verführt und sie zusammenziehen. Wie sie schwanger wird und sie nur per Zufall erfährt, dass es mit Matthias noch jemand anderen für Philipp gibt.
Der erste und einzige Schwulenfilm der DDR ist ein liebevoll inszenierter Liebesfilm und zugleich ein Plädoyer für Toleranz und Individualismus. Sehr moralisch wirkt er heute auch und an manchen Stellen unerträglich didaktisch. Die real existierende Bar „Zum Burgfrieden“, in der Charlotte von Mahlsdorf einen Gastauftritt hat, ist längst geschlossen. Nur noch das Carl-von-Ossietzky-Gymnasium und Philipps gewagte Schlussfahrt auf dem Fahrrad, entlang der Prenzlauer Allee, sind als Original-Drehorte wiederzuerkennen.
Ganze sieben Jahre brauchte Heiner Carow, bis er seinen Film fertigstellen konnte. Immer wieder musste er sich gegen staatliche Versuche wehren, den Film zu zensieren. Am Ende war alles gut. Während der Premiere im Kino International, bei der viel DDR-Prominenz, aber auch die Stasi im Publikum saß, fiel die Mauer. Auch das wurde später als eine Art „Coming out“ (der DDR) aufgefasst.
FLYER „Pankow im DEFA-Film“ - DOWNLOAD
"Eine Zeitreise zu den Anfängen der Kino und Filmgeschichte"
Von Filmpionieren, Kinopalästen und vergessenen Filmstudios – eine Fahrradtour zur Filmgeschichte in Pankow
Die Wiege der deutschen Kinematographie war nicht etwa in Babelsberg, sondern die Bilder lernten laufen … in Pankow! Diesen Ruhm verdankt der Bezirk vor allem den Brüdern Skladanowsky, die als frühe Filmpioniere hier ihre Spuren hinterlassen haben. Ob in der Schönhauser Allee, wo die ersten Filmaufnahmen entstanden, oder im Ballsaal eines Ausfluglokals, wo sie diese zum ersten Mal zeigten. Ausflugslokale oder große Gaststätten der Brauereien waren die ersten Orte, wo in Pankow Filme vorgeführt wurden.
In der Frühzeit des Films entstanden außerdem zahlreiche „Flohkinos“, die sich teilweise in Ladenlokalen befanden. In der Weimarer Republik gesellten sich dann einige große „Filmpaläste“ dazu. Einige davon sind noch erhalten und auf unserer Tour zu sehen. Eine spannende Reise in die Filmgeschichte von Pankow.
Tourenüberblick
Start: Filmtheater am Friedrichshain
Ziel: Kino Blauer Stern
Länge: ca. 12 Kilometer
Dauer: ca. 1 Stunde
Orte der Thementour
1. Filmtheater am Friedrichshain
Bötzowstraße 1–5, 10407 Berlin
Das heutige Filmtheater am Friedrichshain ist eines der ersten Kinos, das nach Ende der Wirtschaftskrise 1923 neu gebaut wurde. Nachdem im Prenzlauer Berg zuvor schon zahlreiche kleine Kinos in Ladenlokalen und Gaststätten Vorführungen anboten, stiegen die Ansprüche der Zuschauer im Laufe der 1920er Jahre immer mehr. Der Neubau des „Olympia-Filmtheaters“, so der ursprüngliche Name des Kinos, entstand auf einem Vergnügungsgelände der „Actien-Brauerei Friedrichshain“. Nachbar des im Februar 1925 eröffneten Kinos war der Saalbau Friedrichshain, von seinen Betreibern als „größter Konzertsaal und Garten Berlins“ angepriesen. Der Kinobau selbst lehnte sich mit seiner Freitreppe und der tempelähnlichen Fassade mit Portikus an klassizistische Architektur an. Architekt Otto Werner war fürr insgesamt drei Kinos in Berlin verantwortlich, von denen nur das Kino am Friedrichshain noch steht. Das Olympia war kein Vorstadtkino mehr, sondern einer der großen Stummfilmpaläste mit 1200 Plätzen, Rang und Orchestergraben. 1927 übernahm die UFA den Betrieb. Im Gegensatz zu dem benachbarten Saalbau ist das Kino kaum beschädigt durch den Krieg gekommen. Zwar sind einige Schmuck- und Stuckelemente verschwunden und die Fassade ist vereinfacht worden. Aber das Kino ist eines der wenigen aus der Zeit der Weimarer Republik, das noch seinen ursprünglichen Bauzweck erfüllt. Allerdings heute unter dem Namen Filmtheater am Friedrichshain. Die „Grande Dame der Berliner Kinos“, wie das Filmtheater auch bezeichnet wird, bietet heute fünf kleinere statt einem großem Abspielraum. Alle sind von einer Bühnenbildnerin farbenfroh und fantasievoll gestaltet worden.
2. Apollo-Lichtspiele
Belforter Straße 15, 10405 Berlin
Wo heute Studierende der Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ spielen und inszenieren, befand sich mehrere Jahrzehnte lang ein Kino. Das Gebäude in der Belforter Straße wurde 1879 als Saalbau fürs Tanzvergnügen, vor dem Kino die anderen Leidenschaft der Berliner, erbaut. Die Umwidmung von Veranstaltungssälen in Kinos war damals keine Seltenheit. 1911 eröffneten im Hinterhaus die „Apollo-Lichtspiele“. Verantwortlich für das Apollo waren die Kinobetreiber und Kinobauherren Czutzka & Co, die mehr als sieben weitere Kinos in Berlin betrieben, wie zum Beispiel das heutige Kino Toni am Antonplatz. Nach einem Jahr änderten sich Name, Betreiber und Konzept. Im „Film und Brettl“ ergänzten Varieté-Einlagen die Stummfilmpräsentationen. Eine weitere Umbenennung erfolgte 1935. Bis zur endgültigen Schließung 1956 hieß das Kino „Roxy“, genau wie das damals berühmteste und mit fast 6000 Plätzen größte Kino der Welt in New York.
Das „Roxy“ im Prenzlauer Berg zählte mit seinen knapp 400 Plätzen zu den kleineren Vertretern seiner Zunft. Nach einigen Jahren Leerstand w rde der Saal ab 1961 wieder bespielt. Zunächst als Berliner Arbeiter- und Studententheater (bat), eines der ersten Laientheater der DDR. Mitgründer war damals Wolf Biermann. Nächster Nutzer war und ist bis heute die Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“ Berlin (HFS), die den Saal als Studiotheater nutzt und den Namen „bat“ weiterführt. Zwar erinnert heute nur noch wenig an das Kino, aber immerhin haben bekannte Schauspieler wie August Diehl oder Julia Jentsch erste Bühnenauftritte in dem „bat“ gefeiert.
3. Ufa-Palast Königsstadt
Schönhauser Allee 10/11, 10119 Berlin
Brauereien und Kinos, Bier und Film: das passt zusammen. Besonders in Berlin. In der Kaiserzeit war die deutsche Reichshauptstadt auch die Brauereihauptstadt. Viele der Brauereien verfügten über Ausschänke, Festsäle oder Biergärten. So auch die „Brauerei Königsstadt AG“ unterhalb der Anhöhe zum Prenzlauer Berg. Ab 1903 erwarteten verschiedene Restaurants, Kneipen, Ladenpassagen, Kegelbahnen, ein Musikpavillon und vor allem ein großer Saalbau mit Festsaal die vergnügungssüchtigen Berliner. In dem Festsaal wurden gelegentlich Filme projiziert. Bei laufendem Betrieb und Ausschank konnten die Gäste von ihren Tischen aus Filme schauen.
Ab 1914 gab es in dem Saal dank eines fest eingebauten Projektors regelmäßige Filmvorführungen. Nachdem die übermächtige Kindl-Brauerei den kleineren Wettbewerber schluckte, endete zwar der Braubetrieb. Aber der große Festsaal wurde 1925 zu einem richtigen Kino umgebaut und als „UFA-Lichtspieltheater Königstadt“ eröffnet. Für die größte Filmfirma Deutschlands boten eigene Kinos die perfekte Möglichkeit, die selbst produzierten Filme zu zeigen. Der Kinoraum hatte mit seinem hohen Tonnengewölbe gewaltige Ausmaße und galt gar als einer der höchsten Lichtspielräume in Deutschland. Die Uraufführung der „Feuerzangenbowle“ mit Heinz Rühmann am 28. Januar 1944 war einer der letzten großen Filmpremieren im Prenzlauer Berg. Kurz darauf wurde das Gebäude zerstört. Heute befindet sich am ehemaligen Standort des Kinos an der Schönhauser Allee eine Ladenzeile und Bürogebäude. Nichts erinnert mehr an das Kino. Dagegen zeugen in der Saarbrücker Straße zahlreiche Gebäude von der einstigen Größe der Königstadt-Brauerei. Auf dem Gelände der ehemaligen Brauerei wird auch wieder Filmgeschichte geschrieben. Hier befinden sich die Produktionsfirma von Wim Wenders sowie weitere Filmfirmen.
4. Prater Lichtspiele
Kastanienallee 7–9, 10435 Berlin
Der 1837 entstandene Prater ist der älteste Biergarten Berlin. Selbst geschmierte Stullen, vor Ort aufgebrühter Kaffee und natürlich frisch gezapftes Bier aus einer Bretterbude unter alten Eichen und Kastanien: so fing es an. Schnell entwickelte sich der Prater von einem Bierausschank zu einer der beliebtesten Ausflugslokale Berlins. Aber auch zu einer Vergnügungsstätte. Dank des Einstiegs der Brauerei Pfefferberg in das Geschäft wurde ein großer Saal gebaut. So konnten auch im Winter Gäste bewirtet werden. Vor allem hatte der Prater nun einen Ort für Versammlungen, für Varieté und Volkstheater – und für ein Kino. Bereits 1903 wurde zu kinematographischen Vorstellungen geladen. „Ausbruch des Vulkans Mont Pelé auf Martinique“ oder „Aladin und die Wunderlampe in 45 Bildern“ hießen die ersten kurzen Filme. In der Filmgaststätte, „Prater Lichtspiele“ genannt, gab es bald ein regelmäßiges Programm. Während Filme gezeigt wurden, schenkten die Kellner weiter Bier aus. Häufig wechselten sich Film- und Varietébetrieb ab. Ein eigenes Kinogebäude entstand 1929 vorne an der Kastanienallee. Mit etwa 700 Plätzen gehörten die „Prater Lichtspiele“ zu einer der größeren Kinos im Prenzlauer Berg. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Kino als „DEFA-Filmtheater Kastanienallee“ weiter bespielt. Zahlreiche DEFA-Filme erlebten hier ihre Uraufführung. 1967 war Schluss mit dem Kinobetrieb. Zuletzt nutzte die Volksbühne den Saal als zweite Spielstätte. Momentan werden Gebäude und der Saal saniert und warten danach auf eine neue Nutzung.
5. Denkmal Gebrüder Skladanowsky
Schönhauser Allee 146, 10435 Berlin
Der Name „Skladanowsky“ auf einem Bodenmosaik, das einen Filmstreifen darstellen soll: dieses unscheinbare Denkmal an dem Eckplatz zwischen Kastanienallee und Schönhauser Allee erinnert an eine frühe Sternstunde des deutschen Films. Am 20. August 1892 standen die Brüder Max und Emil Skladanowsky oben auf dem Dach des Hauses in der Schönhauser Allee 146 und machten erste Filmaufnahmen. Max Skladanowsky war Fotograf und Glasmaler. Schon früh zeigte sich sein Talent als Tüftler und Erfinder. Sein Ziel: er wollte Bilder zum Laufen bringen. Die Aufnahmen seines turnenden Bruder mit einem „Kurbelkiste“ auf dem Dach waren die ersten Versuche. Das Gerät wurde weiterentwickelt. Am 1. November 1895 durften die Brüder im Berliner Varieté Wintergarten erstmals vor großem Publikum ihre Erfindung präsentieren: das Bioskop. Das Publikum reagierte begeistert auf die bewegten Bilder. Ein Kritiker bemerkte: „Der ingeniöse Techniker benutzt hier ergötzliche Momentphotographie und bringt sie in vergrößerter Form zur Darstellung, aber nicht starr, sondern lebendig. Wie er das macht, soll der Teufel wissen.“ In Anzeigen wurde das Bioskop als „interessanteste Erfindung der Neuzeit“ bezeichnet. Vom Kaiserlichen Patentamt erhielt er am selben Tag ein Patent für eine „Vorrichtung zum intermittierenden Vorwärtsbewegen des Bildbandes für photographische Serien“.
Nach mehreren ausverkauften Veranstaltungen im Wintergarten gingen die beiden Brüder mit ihrem Bioskop auf Europa-Tournee. Allerdings wollte keine Bank Kredite für diese bahnbrechende Idee geben. Die Skladanowskys mussten mit ansehen, wie zeitgleich in Frankreich die Brüder Lumières ihren „Kinematographen“ zur Perfektion entwickelten und als die eigentlichen Erfinder des Films gefeiert wurden. Aber den Skladanowskys gebührt der Ruhm der ersten öffentlichen Vorführung, acht Wochen vor den den Lumières. Schon bald zogen sich die Skladanowskys aus dem Filmgeschäft zurück. Die Kreuzung an der Schönhauer Allee ist aber seit 1893 noch häufiger auf die Leinwand gebannt worden, zum Beispiel in dem DEFA-Film „Berlin – Ecke Schönhauser“ (1957).
6. Mila-Lichtspiele in der Brauerei Groterjan
Schönhauser Allee 130, 10437 Berlin
Die Mila-Lichtspiele sind ein weiteres Kino, das aus dem Saal einer Brauereigaststätte entstanden ist. Die Brauerei Groterjan war einer der größten Malzbierproduzenten im Land. „Hat’s Caramel-Bier wohlgetan, dann war’s bestimmt von Groterjan“, hieß es über den Malzbier-Verkaufsschlager. Auf dem Gelände der Brauerei befand sich neben einem großen Biergarten auch der für Brauereigaststätten typische Berliner Festsaal mit Kegelbahn sowie eine Villa mit Erkern und Türmchen für den Brauereigründer. Der Gaststättenbetrieb hatte schon vor dem Ersten Weltkrieg Insolvenz anmelden müssen. In den Saalbau, der nach seinem Eingang an der Milastraße auch „Mila-Festsäle“ genannt wurde, zog 1919 ein Kino mit etwa 500 Plätzen: die „Mila-Lichtspiele“. Wie so viele Kinos in dieser unruhigen Zeit, wechselte es häufig seine Betreiber. Ruhiger wurde es, als 1933 Martha Soliman das Kino erwarb. Ihr ägyptischer Ehemann, Mohammad Soliman, kam 1900 als Zauberkünstler und Feuerschlucker von Kairo nach Berlin und betrieb mehrere Kinos. Seine Frau und ihre drei Töchter führten nach Solimans Tod 1929 dessen Leidenschaft für Film weiter. Erst 1961 wurde das Kino enteignet und bis zur endgültigen Schließung 1965 vom VEB Berliner Filmtheater weitergeführt. Das Kino war inzwischen über einen Eingang von der Schönhauser Allee 130 zu erreichen. Die Gebäude des ehemaligen Brauereikomplexes stehen heute unter Denkmalschutz.
7. Colosseum
Schönhauser Allee 123, 10437 Berlin
Der Umbau einer ehemaligen Wagenhalle der Straßenbahn zum Kino im Jahr 1924 steht für eine weitere Kino-Neueröffnung im Prenzlauer Berg nach der Inflationszeit. Der Architekt Fritz Wilms hatte mit den Decla-Lichtspielen in Weißensee, heute Kino Toni, und dem Alhambra in Charlottenburg schon zwei wichtige Kinos gebaut und entwickelt sich zu einem der wichtigsten Kino-Architekten der Weimarer Republik. Beim Colosseum musste er zunächst das Innere komplett umgestalten. Das Gebäude war 1894 für die „Große Berliner Pferde-Eisenbahn AG“ gebaut waren - als „Pferdebahnhof“ mit Ställen für mehr als 360 Pferde. Mit der Elektrifizierung der Strecke wurde das langgezogene Gebäude bis 1918 zu einem Depot für Straßenbahnwägen. Vor das alte Gebäude setzte Wilms einen Neubau für Kassenhalle, Foyer und ein Restaurant. Der tempelartige Eingang zur Schönhauser Alle mit Säulen und Portikus wirkte wie ein klassischer Theaterbau. Eigentümer des Gebäudes war die Stadt Berlin mit einer eigenen Betreibergesellschaft. 1931 übernahm die UFA auch dieses Kino und gestaltete die Fassade sachlich und modern und mit viel Fläche für riesige Filmplakate und Leuchtreklame um.
Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde das Gebäude nach einem Intermezzo als Spielstätte des Metropol-Theater ein Ost-Berliner Premierenkino. In den letzten drei Jahrzehnten gab es verschiedene Betreiber wie CinemaxX und UCI. Momentan existiert eine Mischnutzung. Drei Säle werden weiter als Kino bespielt. Alte Säulen wie auch das historische Mauerwerk erinnern an die Vergangenheit als Pferdebahndepot.
8. Kino Krokodil
Greifenhagener Straße 32, 10437 Berlin
„Flohkino“, das war der Spitzname für kleine Kinos, meist außerhalb der Innenstadt. Sie hatten nichts mit den großen Filmpalästen zu tun. Meistens befanden sie sich im Erdgeschoss von Wohnhäusern und nutzen leerstehende Läden. „Ladenkino“, “Schlauchkino” oder “Schmales Handtuch” waren andere Bezeichnungen. Das Kino „Krokodil“ in der Greifenhagener Straße ist genauso ein Kino. Allerdings wurde es bereits beim Bau des Wohnhauses fest mit eingeplant. 1912 erfolgten die Fertigstellung und Abnahme durch das Polizeipräsidium, damals noch unter dem Namen „Kino Nord“. Der unscheinbare Eingang war direkt an der Straße. Hinter dem kleinen Eingangsbereich mit Kasse führte eine Tür zum langgezogenen Schlauch. 242 Plätze bot das Kino damals. Es war ein Kino für die Nachbarschaft.
Auch in der DDR wurde das Kino „Nord“ weiter betrieben und erst 1963 geschlossen. Nach mehreren Jahrzehnten Dornröschenschlaf, in dem der Kinosaal kurioserweise als Lager eines Tischlereibetriebs diente, der sich auf Kinostühle und Kinosessel konzentrierte, wurde der Filmbetrieb 1993 wieder aufgenommen. Seit 2004 gibt es neue Betreiber, die sich vor allem dem mittel- und osteuropäischen Kino verschrieben haben. Das Kino „Krokodil“ als Nischenkino wurde schon mehrmals mit Programmkinopreisen ausgezeichnet. Mit mehr als 110 Jahre Geschichte zählt es zu den ältesten in Berlin und gleichzeitig zu einem der ganz wenigen Ladenkinos, das sich in der räumlichen Struktur im Laufe seiner Geschichte kaum verändert hat.
9. Ehemaliges Kino Tivoli / Pankower Feldschlösschen
Berliner Straße 27, 13189 Berlin
In der Berliner Straße 27 hat sich im Jahr 1895 Filmgeschichte abgespielt. In der Gaststätte Sello zeigten die Brüder Max und Emil Skladanowsky erstmals vor ausgesuchtem Publikum ihre selbstgedrehten Filme. Noch bevor sie ihre Erfindung des Bioskops im November im Variétetheater „Wintergarten“ öffentlich einem Massenpublikum präsentierten, bekamen sie in der Gaststätte, eines der typischen Vorort-Gartenlokale, ihre private Bühne. Der Gastwirt Sello hatte die Brüder Skladanowsky schon vorher unterstützt, als er ihnen erlaubte, im Garten seines Lokals Aufnahmen zu machen. Vor einem weißen Vorhang präsentierten bereitwillig einige Varieté-Künstler ihr Können, während die Skladanowskys eifrig filmten. In den Kellerräumen des Lokals durften sie dann ihre Filme entwickeln. Bei der Vorführung saßen im Publikum die Direktoren des angesehenen Wintergarten und waren angetan von den bewegten Bildern. Im Lokal, das zwischenzeitlich kurz „Feldschlößchen“ hieß, wurden danach noch häufiger Filme gezeigt, der Ballsaal immer mehr zum Kinosaal. Unter dem Namen „Pankower Theater“ warb der Ort mit „Vorführungen von Filmen bester Klasse im ersten Lichtspieltheater am Platze“.
Nach dem Abriss des baufälligen Lokals entstand im Jahr 1927 ein eigenständiges Kino mit etwa 800 Plätzen. Das moderne Kino mit dem großen Schriftzug „Tivoli“ über dem Eingang überstand die Luftangriffe unzerstört und der Betrieb wurde in den Nachkriegsjahren fortgesetzt. 1994 erfolgte die Schließung. Trotz Proteste von Bevölkerung und Prominenten wie Wim Wenders, Volker Schlöndorff und Otto Sander konnten Kino und Gebäude nicht vor dem Abriss bewahrt werden. Heute erinnert lediglich ein Mosaik in Form von Filmstreifen mit dem Schriftzug „1885 Bioskop 1995“ auf dem Boden an diese Sternstunde. Gestaltet wurde es, wie auch schon das Denkmal am Beginn der Kastanienallee, von dem Pankower Künstler Manfred Butzmann.
10. Wandbild Max Skladanowsky Filmrollen
Mühlenstraße 15, 13187 Berlin (hinter der Kita)
Nur ein paar hundert Meter entfernt von dem ehemaligen Aufführungsort der ersten Skladanowsky-Filme erinnert ein weiteres Kunstwerk an die Erfindung des Bioskops. Diesmal muss man nicht auf den Boden schauen, sondern auf eine große Brandwand. Hier befindet sich ein „Mural“, ein großes Wandbild. Es zeigt die bekannten Filmstreifen mit runden Perforationslöchern. Gefüllt sind sie anders als bei den beiden Werken von Manfred Butzmann nicht mit Schrift, sondern mit den Bildern. Es sind die Bilder, die den ersten Zuschauern als bewegte Bilder gezeigt wurden: ein Jongleur, ein Paar, das einen italienischen Bauerntanz performt und vor allem das boxende Känguru, das die Gäste im Wintergarten damals besonders begeisterte. 1997 hat das Bezirksamt Pankow einen Wettbewerb zur Gestaltung der Brandmauer ausgeschrieben. Die Idee von Helge Warme hat sich durchgesetzt. Als gebürtiger Pankower waren ihm die Skladanowskys vertraut und es daher lag ihm viel daran, ihre Erfindung zu würdigen. Damals war sein Kunstwerk mit knapp 1000qm eines der größten Wandbilder der Stadt. Heute, nach bald 30 Jahren, ist es auch eines der ältesten noch erhaltenen „Murals“. Allerdings gab es eine Zeit der Ungewissheit, als vor dem Wandbild ein Kindergarten gebaut wurde. Ein Verschwinden des Gemäldes stand zur Disposition. Aber das Ergebnis der Gespräche zwischen Bezirk, Kindergarten und Künstler war kein Ende, sondern eine Fortsetzungsgeschichte: Die Filmbänder finden heute ihre Fortsetzung auf dem Gebäude davor und ziehen sich sogar in das Atrium hinein. Vor allem die Darstellungen der tanzenden Kinder und des boxenden Kängurus dürften den Kindern dort Freude bereiten. Nebenbei erfahren sie etwas über die Geschichte des Films in Pankow.
11. Wohnhaus von Paul Nipkow
Parkstraße 5, 13187 Berlin
Pankow ist aufgrund der Gebrüder Skladanowsky nicht nur die Wiege des Films. Hier lebte auch eine Person, die als einer der Erfinder des Fernsehens gefeiert wird. Paul Nipkow kam aus Pommern nach Berlin, um Mathematik und Physik zu studieren. Ihn beschäftigte die Frage, ob und wie man bewegte Bilder, ähnlich wie Sprache mittels Telefon, übertragen kann. An dem Heiligabend 1883 soll ihm, alleine in seiner Wohnung vor einer Petroleumlampe sitzend, die Eingebung gekommen sein. Eine spiralförmig gelochte Scheibe zerlegte während der Rotation Bilder in einzelnen Punkte, wie ein Mosaik, damit das Bild dann übertragen werden konnte. Das war die Grundlage für mechanische Bildübertragung und damit die technischen Voraussetzung für das Fernsehen. Mit gerade einmal 23 Jahren meldete er seine Erfindung als Patent an. Aber erst Jahrzehnte später kam er, inzwischen Pensionär, auf seine Erfindung zurück. Film hatte sich zu einem Massenmedium entwickelt. Und hektisch war die technische Welt mit der Erfindung des Fernsehens beschäftigt. Nun erinnerte man sich an seine Spirallochscheibe, die „Nipkow-Scheibe“. Sie wurde ein wichtiges Bauelement für das frühe Fernsehen.
1924 meldet er ein neues Patent an. 1928 konnte Nipkow bei der Internationalen Funkausstellung seinen „Fernseher“ bewundern. Zwar setzte sich seine Technik letztlich nicht durch. Statt mechanischer Bildabtastung kam später ein elektronisches Verfahren zum Einsatz. 1897 hatte Ferdinand Braun dafür die sogenannte „Braunsche Röhre“ erfunden. Aber da Nipkow schon zuvor seine Scheibe entwickelte hatte, gebührte ihm eine andere Ehre. Ein Fernsehsender wurde 1935 nach ihm benannt wurde. Nicht irgendeiner. Der Fernsehsender „Paul Nipkow“ war der weltweit erste reguläre Fernsehsender. Kurz nachdem ihm zahlreiche Gäste in seinem Haus in der Parkstraße zu seinem 80. Geburtstag gratuliert haben, starb er. An dem Haus, wo er von 1911 bis zu seinem Tod 1940 gelebt hat, hängt eine Gedenktafel.
12. IFA-Atelier
Heinrich Mann-Straße/Hermann-Hesse-Straße, 13156 Berlin
Die Filmstudios in Babelsberg sind weltbekannt. Auch Weißensee als „Klein Hollywood“ hat seine Spuren in der Filmgeschichte hinterlassen. Aber ein Filmatelier in der Schönholzer Heide im Ortsteil Niederschönhausen? Im Gegensatz zu den beiden berühmten Studios steht hier kein Gebäude mehr, erinnert kaum etwas an die Frühzeit des deutschen Films.
Von 1922 bis 1928 produzierte die Internationale Film A. G. (IFA) zahlreiche Filme in der Schönholzer Heide, einem beliebten Ausflugsort für die Berliner. Das Studiogebäude war das „Alte Schloss“. Eigentlich kein Schloss, sondern ein Gutshof, wurde das prächtige Gebäude um 1800 erbaut. Es war Teil der sogenannten Königinplantage, angelegt unter Königin Elisabeth Christine, der Frau von Friedrich dem Großen. Hier hatte die IFA viel Platz für Atelierräume, Werkstätten und einen eigenen Fundus. Für Außenaufnahmen bot der umliegende Park und die Wälder optimale Bedingungen. Gründer der Studios war Rudolf Meinert. Meinert war einer der wichtigsten Regisseure und Produzente der späten Kaiserzeit und der Weimarer Republik. Neben zahlreichen eigenen Filmen produzierte er zusammen mit Erich Pommer auch „Das Cabinet des Dr. Caligari“. Der erste Film seines eigenen Studios im Schloss Schönholz war „Marie Antoinette“ (1922), ein Historien# lm über das Leben der französischen Königin. Die Kritik lobte insbesondere die Gestaltung und Schlossähnlichen Bauten des Films, errichtet in der Schönholzer Heide. 1928 mussten die Studios Insolvenz anmelden. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg zerstört, Trümmer danach entfernt bzw. zu kleinen Hügeln aufgeschüttet. Einige Mauerreste sind allerdings noch erhalten. Wer diese letzten Reste finden will, muss die Verlängerung der Heinrich Mann-Straße in das Waldgebiet etwa 200 Meter folgen und dann rechts in den Wald hinein. Mit etwas Glück stößt man auf Reste vom alten Schloss Schönholz.
13. Kino Blauer Stern
Hermann-Hesse-Straße 11, 13156 Berlin
Das einzige verbliebene Kino im Ortsteil Pankow hat eine lange Tradition. Wie bei vielen anderen Vorstadt-Kinos wurde das Kino aber nicht als Lichtspieltheater gebaut. Der Vorführraum fand seinen Platz in einem schon bestehenden Gebäude in einen ehemaligen Tanzsaal. Das Gartenlokal existierte seit etwa 1870 und grenzte an eine Grünfläche mit dem Kreuzgraben, einem Entwässerungsgraben der Panke. Um 1900 entstand davor ein Wohnhaus mit Jugendstilelementen. Der Tanzsaal gehörte zum Lokal. Schon früh wurden hier auch Filme gezeigt, als Teil des Vergnügungsangebots in dem Ballsaal. Eine regelmäßiger Kinobetrieb fand allerdings erst ab 1933 statt. Später weichte das Tanzvergnügen komplett dem anderen Lieblingsvergnügen der Berliner. Den Namen „Bismarck-Lichtspiele“ hat seinen Ursprung in dem Namen der damaligen Straße und des benachbarten Platzes, beide an den Reichskanzler erinnernd.
In der DDR wurde aus der Bismarckstraße die Hermann-Hesse- Straße und die Lichtspiele eröffneten 1946 als Kino „Blauer Stern“. Ende der 1980er Jahre schloss auch dieses Kino. Es entstand – zumindest im vorderen Bereich des Gebäudes – wieder ein Restaurant. Aber 1996 wurde der verfallene Kinosaal wieder hergestellt, ein zweiter dazu gebaut und seitdem leuchtet auch der blau-weiße Neonstern am Eingang als der „Blaue Stern“ wieder.
FLYER „Eine Zeitreise zu den Anfängen der Kino und Filmgeschichte“ - DOWNLOAD
TIPP: Audiofeature „Fundort: Filmstudio Schönholz“
Zu der Geschichte des Filmstudios hat das Naturtheaterkollektiv NordOst ein Hörfeature erstellt – eine auditive Reise zu dem ehemaligen Heidetheater in der Schönholzer Heide, das auf den Trümmern des ehemaligen Gutshaus Schloss Schönholz errichtet wurde. 1900 wurde hier eine stadtbekannte Vergnügungsstätte (Gutshaus Schönholz) gebaut – mit großem Tanzsaal und zahlreichen Nebengelassen. Rudolf Meinert erwarb das Gutshaus für sein von 1921 bis 1928 hier tätiges, finanzstarkes Filmstudio.
Audiofeature hier
„Filmspielplatz Pankow - Eine filmische Entdeckungsreise für Kinder und Jugendliche durch den Bezirk“
Berlin mit den Augen von Kindern und Jugendlichen erleben – das bietet diese Tour zu Drehorten und in die Kinogeschichte von Pankow.
Pankow ist ein kinderreicher Bezirk. Nirgendwo leben mehr Familien in Berlin als hier. Grund genug, sich der Film- und Kinogeschichte des Bezirks aus der Perspektive von Kindern und Jugendlichen zu nähern. Die Tour führt zu Drehorten von wichtigen Kinder- und Jugendfilmen, die in Pankow spielen. Sie erzählen nicht nur von einer Erlebniswelt jenseits der Erwachsenen, sondern auch immer etwas von der wechselvollen Geschichte von Berlin.
Zusätzlich kann man auf der Tour auch erfahren, welchen Stellenwert das Kino in Pankow hatte und hat. Damit es nicht zu langweilig wird, gibt es in der App zu jeder Station auch immer kleine Aufgaben zu lösen. Wer am Ende das Lösungswort errät, kann sich einen kleinen Preis im tic in der Kulturbrauerei abholen. Also ab auf den Filmspielplatz Pankow!
FLYER Filmspielplatz Pankow - DOWNLOAD
Tourenüberblick
Start: Husemannstraße
Ziel: Sommerbad Pankow
Länge: ca. 11 Kilometer
Fahrzeit: ca. 45 Minuten
Orte der Thementour
1. Husemannstraße
Husemannstraße zwischen Wörther Straße und Sredzkistraße, 10435 Berlin
Titel: Kai aus der Kiste
Land / Jahr: DDR 1988
Regie: Günter Meyer
Länge: 1 h 33 min / Farbe
Verfügbar: DVD; Prime Video
Kai aus der Kiste spielt 1923, während der großen Inflation in Deutschland. Das Geld verliert rasend schnell an Wert. Kai wohnt mit seiner Mutter und den beiden Geschwistern im Arbeiterbezirk Prenzlauer Berg. Die Familie lebt von der Hand in den Mund und Kai ist immer darauf aus, etwas gegen die Armut in seinem Umfeld zu unternehmen. Als ein reicher amerikanischer Kaugummiproduzent in Berlin auftaucht, der jemanden sucht, der als „Reklamekönig“ die neueste Kaugummimarke bewirbt, wittert Kai seine Chance. Er lässt sich in einer Kiste versteckt zu dem Amerikaner bringen, um sich für die Aufgabe zu bewerben. Aber Kai bekommt Konkurrenz von dem erfahrenen Werbefachmann Herrn Kubalski, mit dem sich Kai nun einen harten Wettkampf liefert. Was folgt, ist nicht nur ein Feuerwerk an originellen Werbeideen von Kai und seinen Freunden, sondern auch eine leichte und doch authentische Darstellung der frühen Zwanziger Jahre in Berlin. Nebenbei gibt es in Kai aus der Kiste auch noch lustige Anspielungen auf alte Stummfilme und einige Musicaleinlagen.
Sowohl für die ärmlichen Hinterhöfe, in denen sich Kai normalerweise rumtreibt, als auch für die schicken Prachtstraßen, auf denen Herr Kubalski zuhause ist, wurde für den Film von 1988 im Prenzlauer Berg gedreht. Die Husemannstraße spielt dabei ein ganz besonders prominente Rolle. Sie war erst kurz vor den Dreharbeiten als eine der wenigen historischen Straßen in Ostberlin aufwendig saniert worden und durfte nun im Film ihren neuen Glanz zeigen.
2. Spielplatz am Helmholtzplatz
Raumerstraße 6, 10437 Berlin
Titel: Spielplatz (Doku)
Land / Jahr: DDR 1966
Regie: Heinz Müller
Länge: 13 min / sw
Verfügbar: DVD (enthalten in Prenzlauer Berginale Kiezfilme 1965–2004)
Titel: Einmal in der Woche schrein (Doku)
Land / Jahr: DDR 1982
Regie: Günter Jordan
Länge: 17 min / Farbe
Verfügbar: DVD (enthalten in Prenzlauer Berginale Kiezfilme 1965–2004)
Seit knapp zehn Jahren gibt es im Bezirk Pankow ein eigenes kleines Filmfestival. Die „Prenzlauer Berginale“ – der Name ist natürlich eine Anspielung auf die große Berlinale – präsentiert Spiel- und Dokumentarfilme, die einen Bezug zu dem berühmten Ortsteil von Pankow haben, und sorgt dafür, dass einige vergessene Filmperlen wieder ein größeres Publikum finden. Zu den Wiederentdeckungen gehören auch die beiden Kurz-Dokus Spielplatz und Einmal in der Woche schrein. In beiden Filmen steht der Helmholtzplatz im Mittelpunkt. In Spielplatz aus den 1960er Jahren wird der Helmholtzplatz als grüne Oase inmitten der Mietshäuser vorgestellt, auf der sich Kinder und Jugendliche, Mütter und Großeltern, Schach- und Skatspieler treffen. Hier kommt die Nachbarschaft zusammen und alle finden ihren Platz. Etwas lauter und weniger beschaulich geht es in Einmal in der Woche schrein aus den frühen 1980er Jahren zu. Die Doku begleitet Jugendliche, die am Helmholtzplatz abhängen, mit ihren Mopeds posen und die neuesten Modetrends vorführen. Sie haben sich am Helmholtzplatz in einem Ladenlokal auch einen kleinen Club geschaffen, in dem sie ein Konzert der Rockband „Pankow“ organisieren – und bei Club-Cola und Schmalzstulle unter sich sein können.
Der Helmholtzplatz ist auch heute noch ein Treffpunkt für Jung und Alt. Mit den Filmen kann man sich auf eine kleine Zeitreise begeben und feststellen, dass sich vieles geändert hat, aber einiges auch immer gleich bleiben wird. Es sieht nur anders aus.
3. Kreuzung U-Bahnhof Eberswalder Straße
Pappelallee 1, 10437 Berlin
Titel: Berlin – Ecke Schönhauser
Land / Jahr: DDR 1957
Regie: Gerhard Klein
Länge: 1 h 19 min / sw
Verfügbar: DVD; Prime Video / alles kino
Titel: Ikarus
Land / Jahr: DDR 1975
Regie: Heiner Carow
Länge: 1 h 28 min / Farbe
Verfügbar: DVD
Es ist nicht nur irgendeine Straßenkreuzung, es ist DIE Film-Kreuzung im Prenzlauer Berg, eigentlich von ganz Berlin! Der Film Berlin – Ecke Schönhauser von 1957 gab dem Straßengewirr am U-Bahnhof Eberswalder Straße nicht nur den Spitznamen, sondern ist auch ein echter Berlinfilm-Klassiker. Berlin – Ecke Schönhauser erzählt von der Lebenswelt junger Menschen in Ostberlin in den 1950er Jahren, als Berlin noch ohne Mauer ist. Die Spuren des Zweiten Weltkriegs sind noch überall spürbar, im Stadtbild genauso wie in den Familien. Im Osten fehlt es an Geld, an Lehrstellen, an Wohnungen, dafür gibt es sozialistische Hilfe durch die Jugendorganisation FDJ. Der Westen lockt mit mehr Glanz und neuen Perspektiven, ist aber auch nicht das goldene Paradies, als das er sich verkaufen will. Gewalt ist allgegenwärtig, aber auch der Hunger nach Liebe und Glück. Treffpunkt der heranwachsenden Jungs – und des Mädchens Angela – ist die „Ecke“, wo sie bei Musik und Mutproben „cornern“. Auch wenn das damals noch nicht so hieß.
Seitdem ist die „Ecke Schönhauser“ in zahlreichen Filmen immer wieder in Szene gesetzt worden und gilt bis heute als das filmische Zitat für den Prenzlauer Berg. Sie hat mit der besonderen Straßenführung und der Hochbahnstrecke auch einen hohen Wiedererkennungswert. So weiß man zum Beispiel auch in dem Film Ikarus von 1975 gleich, dass die Hauptfigur Mathias in der Nähe der Kreuzung mit seiner Mutter in einem Altbau wohnt. Die Eltern sind geschieden und Mathias 9. Geburtstag steht vor der Tür. Als Mathias von seinem Vater von der griechischen Sage des Ikarus hört und glaubt, sein Vater werde ihm zum Geburtstag einen Flug über Berlin schenken, bahnt sich eine Enttäuschung an. Ikarus ist ein sensibles Porträt eines Scheidungskindes, dass heute noch genauso relevant ist wie zu seiner Entstehungszeit.
4. Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark
Cantianstraße 24, 10437 Berlin
Titel: 1-2-3 Corona
Land / Jahr: D 1948
Regie: Hans Müller
Länge: 1 h 26 min / sw
Verfügbar: DVD
Die große Zeit der Zirkusse ist Geschichte, aber Clowns und Artisten in der Manege begeistern immer noch kleine und große Zuschauer. Die meisten festen Zirkusse in Berlin gibt es heute im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, in Pankow leider keinen mehr. Bevor der Friedrich-Ludwig-Jahn Sportpark errichtet wurde, hatte an gleicher Stelle, auf einem ehemaligen Exerzierplatz, der berühmte Circus Barlay einmal sein Quartier. Hier und in der Zirkuswelt überhaupt spielt der Film 1-2-3 Corona. Corona ist darin nicht der Name eines Virus, sondern so heißt eine junge Artistin, die mit ihrem Wanderzirkus in Berlin auftaucht.
Es ist der Sommer 1945, kurz nach Ende des Zweiten Weltkriegs. Berlin liegt in Trümmern. Die Schulen sind noch geschlossen, dafür wird zwischen den Ruinen nun jongliert, gezaubert und am Trapez geturnt. Corona lernt die zwei elternlosen Jungen Gerhard und Dietrich kennen, die auf dem Schwarzmarkt mit Kohlen und Zigaretten handeln. Durch eine Dummheit verursachen die Jungs einen schweren Unfall von Corona. Die Krankenhäuser sind voll und ihr Wanderzirkus lässt sie im Stich, und so übernehmen Gerhard und Dietrich selbst die Pflege von Corona. Um sie aufzuheitern, stellen die Jungs, unter der Anleitung von Corona, einen eigenen kleinen Zirkus auf die Beine. Bis schließlich sogar der Direktor des großen Circus Barlay auf sie aufmerksam wird.
Natürlich gibt es in diesem sogenannten „Trümmerfilm“ wenig, was an das heutige Berlin erinnert. In der Darstellung einer Jugend in Zeiten großer Not und Zerstörung, die sich ihre Träume nicht nehmen lässt, ist aber 1-2-3 Corona ein wichtiges und spannend erzähltes Zeitdokument.
5. Filmtheater Colosseum
Schönhauser Allee 123, 10437 Berlin
Zehn Kinos gibt es heute noch im Bezirk Pankow. Unter ihnen hat das Colosseum wahrscheinlich die ungewöhnlichste Geschichte. Denn angefangen hat hier alles einmal mit Pferden für die Berliner Straßenbahn. 1894 war das Gebäude als Pferdebahnhof für die „Große Berliner Pferde-Eisenbahn AG“ errichtet worden. Als die Pferde für die Bahn nicht mehr gebraucht wurden, wird aus den Stallungen ein Depot für Straßenbahnwagen. 1924 wird der Raum dann endlich zu einem Kinosaal umgebaut. Der Eingang mit der Kassenhalle wird wie ein klassisches Theater mit Säulen geschmückt. Aber schon bald darauf wird die Fassade wieder schlichter gestaltet, damit an der großen Außenfläche viel Platz für Filmplakate und Leuchtreklame bleibt. Nach dem Zweiten Weltkrieg wird das Colosseum tatsächlich kurz zur Spielstätte eines Theaters, bis wieder der Kinobetrieb aufgenommen wird und hier ein Ostberliner Premierenkino entsteht.
Nach der Wende wird das Colosseum von verschiedenen großen Kinoketten betrieben. Aber hier hat auch immer die kleine Filmkunst ein Zuhause gehabt, zum Beispiel als Spielstätte der Berlinale. Heute wird im Colosseum nach ein paar Umbauarbeiten eine Mischnutzung aus Kino, Kultur- und Veranstaltungsort betrieben. So kann man hier nun nicht nur Filme gucken, sondern zum Beispiel auch einen coolen Weihnachtsmarkt oder kleine Festivals besuchen. Nur für Pferde ist nach wie vor kein Platz mehr. Aber ein paar alte Säulen im Innenraum und historische Mauern erinnern immer noch an die Anfänge als Pferdebahndepot.
6. U-Bahnhof Schönhauser Allee
Schönhauser Allee 75, 10439 Berlin
Titel: Der tapfere Schulschwänzer
Land / Jahr: DDR 1967
Regie: Winfried Junge
Länge: 1 h 07 min / Farbe
Verfügbar DVD
Ein schöner Sommertag in Berlin. Der Viertklässler Thomas bringt morgens erst noch seinen Bruder in den Kindergarten, bevor er sich auf den Weg zur Schule macht. Thomas ist ein kleiner Träumer und lässt sich vom Trubel der Stadt gerne ablenken. Zum Beispiel nimmt er lieber die U-Bahn zwischen den Bahnhöfen Schönhauser Allee und Eberswalder Straße (der damals Bahnhof Dimitroffstraße heißt), als die eine Station zur Schule zu laufen. So kann er von oben die spannende Aussicht genießen. Aber irgendwie ist dieser Tag grundsätzlich zu schön für Schule, und die Weiterfahrt mit der Bahn in den Tunnel scheint für Thomas auch interessanter. Und so kommt es, dass der Junge um 8 Uhr morgens, statt im Klassenzimmer zu sitzen, plötzlich am Alexanderplatz steht, an dem gerade viele neue Häuser gebaut werden. Aber das wird nicht das Aufregendste sein, was Thomas an diesem Tag erlebt, als er die Schule schwänzt …
Der tapfere Schulschwänzer von 1967 begleitet auf fast dokumentarische Weise seinen kleinen Helden auf einer Entdeckungstour durch Berlin, die im Prenzlauer Berg ihren Anfang nimmt. So sieht man zu Beginn des Films ein wildes Straßentreiben, hektisch und laut, und mindestens so großstädtisch wie heute. Und wenn man ehrlich ist, kann man Thomas ja auch verstehen: Die U-Bahn-Trasse der U2, die kurz nach der Eberswalder Straße im Boden versinkt, ist tatsächlich ein faszinierendes Stück Prenzlauer Berg!
7. Heinrich-Schliemann-Gymnasium
Dunckerstraße 64, 10439 Berlin
Titel: Sheriff Teddy
Land / Jahr: DDR 1957
Regie: Heiner Carow
Länge: 1 h 08 min / sw
Verfügbar: DVD
An der Schule in der Dunckerstraße herrschen schlimme Zustände: Schlagringe fliegen durch den Klassenraum, verbotene Magazine machen die Runde, und es gibt wilde Prügeleien auf dem Schulhof. Das liegt an Sheriff Teddy, dem Neuen an der Schule, in dem gleichnamigen Film von 1957.
Sheriff Teddy heißt eigentlich Kalle, wohnte vor kurzem noch in West-Berlin und ist dort der Chef einer kleinen Bande. Nun ist Kalle mit der Familie nach Ostberlin gezogen, in den Prenzlauer Berg. Hier eckt Kalle sofort an, hat immer eine große Klappe und gehörig Wut im Bauch. Sein großer Bruder verstrickt ihn zudem in krumme Schmuggelgeschäfte. Aber der verständnisvolle neue Lehrer bringt Kalle letztlich auf die richtige Bahn, und ein Mitschüler wird vom Gegner zum Freund. Sheriff Teddy erzählt von einem Berlin vor dem Mauerbau, einer noch durchlässigen Stadt mit zwei unterschiedlichen politischen Systemen. Nicht nur die Jungen raufen sich auf dem Schulhof. Die ganze Stadt ringt darum, ob nun im Westen oder Osten das Leben besser ist. Und der DEFA-Film lässt keinen Zweifel daran, auf welcher Seite er steht. Sheriff Teddy ist als Film ein Kind seiner Zeit und hat natürlich Elemente eines Propagandastreifens. Aber wie Kalle es schafft, die Gewalt hinter sich zu lassen, neue Freunde und einen neuen Weg für sich zu finden, ist immer noch spannend anzusehen und hat eine zeitlos sehenswerte Botschaft.
Kalles neue Schule im Prenzlauer Berg ist das heutige Heinrich-Schliemann-Gymnasium, das oft prominent ins Bild gesetzt wird. Auf der Website des Gymnasiums steht, dass es sich „als Institution versteht, die Brücken bauen möchte“. Das passt doch ganz gut.
8. Kino Krokodil
Greifenhagener Straße 32, 10437 Berlin
Bei Kinonamen geht es manchmal tierisch zu. „Flohkino“ zum Beispiel war früher der Spitzname für kleine Kinos, die meist außerhalb der Innenstadt lagen. Sie hatten nichts mit den großen Filmpalästen zu tun. Meistens befanden sie sich im Erdgeschoss von Wohnhäusern und nutzten leerstehende Läden. „Schlauchkino“ oder „Schmales Handtuch“ wurden sie auch genannt. Das Kino Krokodil in der Greifenhagener Straße ist genauso ein Kino. Es wurde aber bereits beim Bau des Wohnhauses fest mit eingeplant. 1912 eröffnete es unter dem Namen „Kino Nord“. Der unscheinbare Eingang war direkt an der Straße. Hinter dem kleinen Eingangsbereich mit Kasse führte eine Tür zu einem langgezogenen Schlauch. Es war ein typisches Kino für die Nachbarschaft.
Auch nach dem Krieg wurde das „Nord“ weiter betrieben und erst 1963 geschlossen. Auf kuriose Weise blieb der Ort aber mit dem Filmgeschäft verbunden: Er diente als Lager einer Tischlerei, die sich auf Kinostühle spezialisiert hatte. Erst ab 1993 wurden hier endlich wieder Filme gezeigt. Seit 2004 gibt es einen neuen Namen und neue Betreiber, die sich vor allem dem mittel- und osteuropäischen Kino verschrieben haben. Das „Krokodil“ ist seitdem mit vielen Programmkinopreisen ausgezeichnet worden. Hatte das kleine Kino früher unvorstellbare 242 Plätze, sind es heute nur noch ein Drittel so viel. Dafür geht es jetzt viel bequemer zu. In jeder Reihe gibt es sogar einen kleinen Tisch zwischen den Stühlen. Mit mehr als 110 Jahren Geschichte zählt das Kino Krokodil zu den ältesten in Berlin und gleichzeitig zu einem der ganz wenigen Ladenkinos, die sich in seiner Struktur im Laufe der Jahrzehnte kaum verändert haben.
9. Wandbild Skladanowsky Filmrollen
Mühlenstraße 15, 13187 Berlin (hinter der Kita)
Film und Kinder – nirgendwo kommt das in Pankow eindrücklicher zusammen als in der Mühlenstraße 15. Denn an der Brandmauer über einer Kita ist ein großes Wandbild gemalt, das an die Anfänge des Kinos und des Films in Berlin erinnert. Es zeigt einen typischen analogen Filmstreifen mit seitlichen Löchern. Zu sehen sind darauf Szenen, die die Berliner Ende des 19. Jahrhunderts erstmals als sogenannte „lebende Bilder“ auf einer Leinwand zu sehen bekamen: ein Jongleur, ein italienischer Bauerntanz und vor allem ein boxendes Känguru, das damals besonders für Begeisterung sorgte.
Diese Filmszenen hatten die Pankower Brüder Max und Emil Skladanowsky aufgenommen und 1895 in Berlin im berühmten Varieté Wintergarten mit einen eigens dafür entwickelten Projektor, dem sogenannten Bioskop, vorgeführt. Die erste Vorstellung überhaupt mit insgesamt acht unterschiedlichen Szenen fand aber ganz in der Nähe des heutigen Wandbildes statt, in einem kleinen Pankower Lokal in der Berliner Straße 14. Aus dem Lokal wurde später ein richtiges Kino, aber auch das gibt es längst nicht mehr und heute steht an gleicher Stelle ein Supermarkt.
Nur ein kleiner Mosaikstreifen erinnert im Boden vor dem Supermarkt an den Ort, an dem einst Filmgeschichte geschrieben wurde. Das Wandbild in der Mühlenstraße ist da auf jeden Fall auffälliger. Es gibt es schon seit 1997 und ist fast 1.000 Quadratmeter groß. Damit gehört es zu den ältesten und größten sogenannten „Murals“ in Berlin. Mittlerweile reicht es sogar bis in den Kindergarten hinein. Und so sorgen die berühmten Filmszenen von Max und Emil Skladanowsky noch heute für Staunen bei Groß und Klein.
10. Carl-von-Ossietzky-Gymnasium
Görschstraße 42/44, 13187 Berlin
Titel: Sonnenallee
Land / Jahr: D 1999
Regie: Leander Haußmann
Länge: 1 h 41 min / Farbe
Verfügbar: DVD; Prime Video
Es ist das Jahr 1973 in Ostberlin. Micha und seine Freunde wohnen am kürzeren Ende der Sonnenallee im Schatten der Berliner Mauer und stehen kurz vor dem Abitur. Die Gedanken der Jungs drehen sich um die Frage, ob man sich nach der Schulzeit für drei Jahre bei der Nationalen Volksarmee verpflichten sollte, um verbotene Rockmusik aus dem Westen und natürlich um Mädchen. Manchmal erschreckt die Clique auch aus Spaß Touristen aus West-Berlin, die den Osten besuchen.
In lockeren, historisch nicht immer ganz korrekten Episoden erzählt der Film Sonnenallee aus dem Jahr 1999 von dem ganz normalen Wahnsinn des Heranwachsens – unter den Bedingungen des „real existierenden Sozialismus“. Es ist eine unterhaltsame Reise in die großen und kleinen Nöte, die das Leben im Ostteil von Berlin bestimmt haben. Die schöne Aula im dritten Stock des heutigen Carl-von-Ossietzky-Gymnasiums wird dabei im Film zur Aula der „EOS Wilhelm Pieck“, die Micha und seine Freunde besuchen. Hier findet im Film eine denkwürdige politische Veranstaltung statt, auf der Micha aber nur Augen und Ohren für seinen Schwarm Miriam hat.
Der beeindruckende alte Schulkomplex in Pankow hat aber nicht nur in Sonnenallee mit engagierten DDR-Schülern zu tun gehabt. 1988 waren dortige Abiturienten wegen DDR-kritischer Wandzeitungen und Unterschriftenlisten ins Visier der Schulleitung geraten und in einem schulinternen Tribunal vorgeführt worden. Einige wurden sogar der Schule verwiesen. Die harte Vorgehensweise wurde zum Skandal, selbst West-Berliner Schüler solidarisierten sich mit den Schülern aus dem Osten. Aber erst nach der Wende konnten die in Ungnade gefallenen Schüler ihr Abitur endlich ablegen. Von solch harter politischer Realität ist Sonnenallee weit entfernt. Vielleicht war der preisgekrönte Film auch deshalb ein großer Erfolg an der Kinokasse.
11. Heynstudios
Heynstraße 15, 13187 Berlin
Titel: Der Greif
Land / Jahr: D 2023 (1 Staffel, 6 Folgen)
Regie: Sebastian Marka, Max Zähle
Länge: ca. 1 h je Folge / Farbe
Verfügbar: Prime Video
Wer auf Stranger Things oder Dark steht, also auf Fantasy-Mystery gemixt mit Retro-Charme, dem könnte auch die Serie Der Greif gefallen. Sie basiert auf dem gleichnamigen Roman von Wolfgang und Heike Hohlbein aus dem Jahr 1989. Für die Verfilmung wurde die Geschichte ins Jahr 1994 verlegt. Sie spielt in der fiktiven Kleinstadt Krefelden, wo der 16-jährige Mark gemeinsam mit seinem großen Bruder Thomas und seinem Freund Memo einen Plattenladen betreibt. Zu den Jungs stößt noch Becky, die neu in der Stadt ist. Zwischen ihr und Mark knistert es, doch fürs Verlieben bleibt kaum Zeit, weil ein geheimnisvolles Buch und eine alte Familientradition dazu führen, dass Thomas in eine fremde, unheimliche Welt entführt wird, in der ein grausames Wesen herrscht, der Greif. Mark scheint besondere Fähigkeiten zu haben, von denen er bis vor kurzem noch gar nichts wusste. Und ihm bleibt, gemeinsam mit Memo und Becky, nichts anderes übrig, als den Greif zu bekämpfen, um Thomas – und unsere Welt – zu retten.
Die sechs Episoden von Der Greif sind bildgewaltig, manchmal auch ziemlich gruselig und sind ein echtes Fantasy-Erlebnis. Für das etwas bodenständigere Retro-Feeling der Serie sorgt der Plattenlatten der Brüder, der den schönen Namen „Das Orakel von LP“ trägt. Gedreht wurde dafür im Hinterhof der Heynstudios. Auch der Drehort für ein Büro wurde dort eingerichtet. Die Heynstudios mit dem schönen Backsteinlook und den wandelbaren Innenräumen sind in den letzten Jahren ein beliebter Drehort in Pankow geworden, in dem auch schon Musikvideos entstanden sind.
12. Sommerbad Pankow
Wolfshagener Straße 91–93, 13187 Berlin
Titel: Alfons Zitterbacke
Land / Jahr: DDR 1966
Regie: Konrad Petzold
Länge: 1 h 6 min / Farbe
Verfügbar: DVD; Prime Video
Zitterbacke – was für ein Nachname! Kein Wunder, dass der 10-jährige Alfons darunter leidet. Aber das ist nicht das einzige Problem von Alfons. Eigentlich will der Pechvogel immer alles richtig machen, und schlittert dann doch von einer Peinlichkeit in die nächste. Da kann es schon mal passieren, dass Alfons aus Versehen 60 Eier essen will, dem Vater die dicksten Fische wegangelt oder im Schwimmbad für Aufregung sorgt. Überhaupt kann er es seinem Vater nie recht machen, der aus Alfons einen echten „Zitterbacke“ machen möchte. Zum Glück hat Alfons eine blühende Fantasie, in die er sich regelmäßig flüchtet und in der er immer der Held ist. Dann setzt sich Alfons auch noch in den Kopf, Kosmonaut zu werden und fängt schon mal mit dem Training für seinen Flug in den Weltraum an. Aber damit nimmt das Unheil erst recht seinen Lauf …
Alfons Zitterbacke aus dem Jahr 1966 ist die Verfilmung eines beliebten Kinderbuchklassikers von Gerhard Holtz-Baumert. Gedreht wurde hauptsächlich in Jena, aber die Schwimmbadszenen entstanden im Sommerbad Pankow. Das war erst kurz vor den Dreharbeiten gebaut worden und strahlt in dem Film noch ganz neu in bunten Farben. In einer seiner Fantasien gelingt Alfons dort auch ein perfekter Kopfsprung vom 10-Meter- Turm. Das wäre heute leider nicht mehr möglich. Bei der Sanierung des Sommerbads im Jahr 2000 wurde der Sprungturm gekürzt. Alfons müsste sich also mit 7,5 Metern begnügen. Aber auch das ist ja schon ganz schön hoch.
In den letzten Jahren sind die Geschichten um Alfons Zitterbacke wieder neu verfilmt worden, aber nur in dem sympathischen Original ist das
schöne Sommerbad Pankow zu sehen.